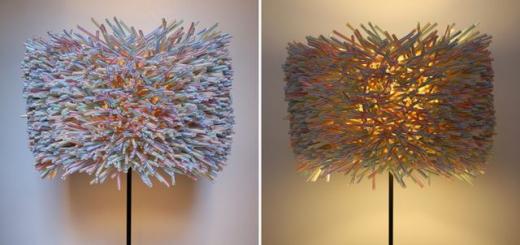Aktuelle Seite: 1 (Buch hat insgesamt 13 Seiten) [verfügbare Lesepassage: 9 Seiten]
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Kapitel 1
Familie Robinson. – Seine Flucht aus dem Haus seiner Eltern
Seit meiner frühen Kindheit liebte ich das Meer mehr als alles andere auf der Welt. Ich beneidete jeden Seemann, der sich auf eine lange Reise begab. Stundenlang stand ich am Meeresufer und ließ die vorbeifahrenden Schiffe nicht aus den Augen.
Meinen Eltern gefiel es nicht besonders. Mein Vater, ein alter, kranker Mann, wollte, dass ich ein wichtiger Beamter werde, am königlichen Hof diente und ein hohes Gehalt bekäme. Aber ich habe von Seereisen geträumt. Es schien mir das größte Glück zu sein, durch die Meere und Ozeane zu wandern.
Mein Vater erriet, was mir durch den Kopf ging. Eines Tages rief er mich an und sagte wütend:
– Ich weiß: Du willst von zu Hause weglaufen. Das ist verrückt. Du musst bleiben. Wenn du bleibst, werde ich dir ein guter Vater sein, aber wehe dir, wenn du wegläufst! „Hier zitterte seine Stimme und er fügte leise hinzu:
- Denken Sie an Ihre kranke Mutter ... Sie wird die Trennung von Ihnen nicht ertragen können.
Tränen funkelten in seinen Augen. Er liebte mich und wollte das Beste für mich.
Der alte Mann tat mir leid, ich beschloss fest, im Haus meiner Eltern zu bleiben und nicht mehr an Seereisen zu denken. Aber leider! – Mehrere Tage vergingen, und von meinen guten Vorsätzen blieb nichts übrig. Es zog mich wieder an die Meeresküste. Ich begann von Masten, Wellen, Segeln, Möwen, unbekannten Ländern und den Lichtern von Leuchttürmen zu träumen.
Zwei oder drei Wochen nach meinem Gespräch mit meinem Vater beschloss ich schließlich, wegzulaufen. Da ich eine Zeit wählte, in der meine Mutter fröhlich und ruhig war, ging ich auf sie zu und sagte respektvoll:
„Ich bin bereits achtzehn Jahre alt und diese Jahre sind zu spät, um das Richten zu erlernen. Selbst wenn ich irgendwo in den Dienst eingetreten wäre, wäre ich nach ein paar Jahren trotzdem in ferne Länder geflohen. Ich möchte so gerne fremde Länder sehen, sowohl Afrika als auch Asien besuchen! Selbst wenn ich an etwas hänge, habe ich immer noch nicht die Geduld, es bis zum Ende durchzuziehen. Ich bitte Sie, meinen Vater zu überreden, mich zumindest für kurze Zeit zur Probe zur See fahren zu lassen; Wenn mir das Leben als Seemann nicht gefällt, werde ich nach Hause zurückkehren und nie woanders hingehen. Mein Vater soll mich freiwillig gehen lassen, sonst bin ich gezwungen, das Haus ohne seine Erlaubnis zu verlassen.
Meine Mutter wurde sehr wütend auf mich und sagte:
„Ich bin überrascht, wie du nach deinem Gespräch mit deinem Vater über Seereisen nachdenken kannst!“ Schließlich hat dein Vater verlangt, dass du die fremden Länder ein für alle Mal vergisst. Und er versteht besser als Sie, welches Geschäft Sie machen sollten. Wenn du dich selbst zerstören willst, geh natürlich auch in dieser Minute weg, aber du kannst sicher sein, dass dein Vater und ich deiner Reise niemals zustimmen werden. Und vergebens hofften Sie, dass ich Ihnen helfen würde. Nein, ich werde meinem Vater kein Wort über deine bedeutungslosen Träume sagen. Ich möchte nicht, dass du später, wenn das Leben auf See dich in Armut und Leid bringt, deiner Mutter Vorwürfe machen könntest, dass sie dich verwöhnt.
Dann, viele Jahre später, erfuhr ich, dass meine Mutter meinem Vater dennoch unser gesamtes Gespräch Wort für Wort übermittelte. Der Vater war traurig und sagte seufzend zu ihr:
– Ich verstehe nicht, was er will? In seiner Heimat konnte er leicht Erfolg und Glück erreichen. Wir sind keine reichen Leute, aber wir haben einige Mittel. Er kann bei uns leben, ohne etwas zu brauchen. Wenn er auf eine Reise geht, wird er große Strapazen erleben und bereuen, dass er nicht auf seinen Vater gehört hat. Nein, ich kann ihn nicht zur See fahren lassen. Weit weg von seiner Heimat wird er einsam sein, und wenn ihm Ärger widerfährt, wird er keinen Freund haben, der ihn trösten könnte. Und dann wird er seine Rücksichtslosigkeit bereuen, aber es wird zu spät sein!
Und doch lief ich nach ein paar Monaten von zu Hause weg. Es ist so passiert. Eines Tages fuhr ich für mehrere Tage in die Stadt Gull. Dort traf ich einen Freund, der mit dem Schiff seines Vaters nach London fahren wollte. Er begann mich zu überreden, mit ihm zu gehen, indem er mich mit der Tatsache in Versuchung führte, dass die Fahrt mit dem Schiff kostenlos sein würde.
Und so, ohne Vater oder Mutter zu fragen, zu einer unfreundlichen Stunde! - Am 1. September 1651, in meinem neunzehnten Lebensjahr, bestieg ich ein Schiff nach London.
Es war eine schlimme Tat: Ich habe meine alten Eltern schamlos im Stich gelassen, ihren Rat missachtet und meine kindliche Pflicht verletzt. Und ich musste sehr bald bereuen, was ich getan hatte.
Kapitel 2
Erste Abenteuer auf See
Kaum hatte unser Schiff die Mündung des Humber verlassen, wehte ein kalter Wind aus Norden. Der Himmel war mit Wolken bedeckt. Es begann eine kräftige Schaukelbewegung.
Ich war noch nie zuvor auf See gewesen und fühlte mich schlecht. Mein Kopf begann sich zu drehen, meine Beine begannen zu zittern, mir wurde übel und ich wäre fast gestürzt. Jedes Mal, wenn eine große Welle das Schiff traf, kam es mir vor, als würden wir sofort ertrinken. Jedes Mal, wenn ein Schiff von einem hohen Wellenkamm fiel, war ich mir sicher, dass es nie wieder aufstehen würde.
Tausendmal habe ich geschworen, dass ich, wenn ich am Leben bleibe, wenn ich wieder festen Boden betrete, sofort nach Hause zu meinem Vater zurückkehren und in meinem ganzen Leben nie wieder einen Fuß auf das Deck eines Schiffes setzen würde.
Diese klugen Gedanken hielten nur so lange an, wie der Sturm tobte.
Aber der Wind ließ nach, die Aufregung ließ nach und ich fühlte mich viel besser. Nach und nach gewöhnte ich mich an das Meer. Zwar war ich noch nicht ganz von der Seekrankheit befreit, aber am Ende des Tages hatte sich das Wetter aufgeklärt, der Wind hatte völlig nachgelassen und ein herrlicher Abend war angebrochen.
Ich habe die ganze Nacht tief und fest geschlafen. Am nächsten Tag war der Himmel genauso klar. Das ruhige Meer mit völliger Ruhe, alles von der Sonne beleuchtet, bot ein so schönes Bild, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Von meiner Seekrankheit war keine Spur mehr übrig. Ich beruhigte mich sofort und fühlte mich glücklich. Überrascht schaute ich mich auf dem Meer um, das gestern noch gewalttätig, grausam und bedrohlich wirkte, heute aber so sanft und sanft war.
Dann kommt wie mit Absicht mein Freund, der mich dazu verleitet hat, mit ihm zu gehen, auf mich zu, klopft mir auf die Schulter und sagt:
- Na, wie fühlst du dich, Bob? Ich wette, du hattest Angst. Geben Sie es zu: Sie hatten gestern große Angst, als der Wind wehte?
- Gibt es eine Brise? Schöne Brise! Es war ein toller Sturm. Ich könnte mir einen so schrecklichen Sturm gar nicht vorstellen!
- Stürme? Oh, du Narr! Glaubst du, das ist ein Sturm? Nun ja, Sie sind noch neu am Meer: Kein Wunder, dass Sie Angst haben ... Auf geht's, bestellen wir Punsch, trinken ein Glas und vergessen den Sturm. Schauen Sie, wie klar der Tag ist! Herrliches Wetter, nicht wahr?
Um diesen traurigen Teil meiner Geschichte abzukürzen, möchte ich nur sagen, dass es bei Seeleuten wie immer lief: Ich betrank mich und ertränkte alle meine Versprechen und Schwüre, alle meine lobenswerten Gedanken über die sofortige Rückkehr nach Hause im Wein. Sobald die Ruhe kam und ich keine Angst mehr hatte, dass die Wellen mich verschlucken würden, vergaß ich sofort alle meine guten Vorsätze.

Am sechsten Tag sahen wir in der Ferne die Stadt Yarmouth. Der Wind war nach dem Sturm Gegenwind, so dass wir sehr langsam vorankamen. In Yarmouth mussten wir vor Anker gehen. Wir standen sieben oder acht Tage lang da und warteten auf einen guten Wind.
In dieser Zeit kamen viele Schiffe aus Newcastle hierher. Wir hätten jedoch nicht so lange gestanden und wären mit der Flut in den Fluss gegangen, aber der Wind wurde frischer und nach fünf Tagen wehte er mit aller Kraft. Da die Anker und Ankertaue auf unserem Schiff stark waren, zeigten unsere Matrosen nicht die geringste Beunruhigung. Sie waren davon überzeugt, dass das Schiff absolut sicher war, und widmeten, wie es unter Seeleuten üblich war, ihre gesamte Freizeit lustigen Aktivitäten und Vergnügungen.
Am neunten Tag jedoch wurde der Wind am Morgen noch frischer und bald brach ein schrecklicher Sturm aus. Sogar die erfahrenen Segler hatten große Angst. Mehrmals hörte ich, wie unser Kapitän mich in die Kabine hinein- und hinausging und mit leiser Stimme murmelte: „Wir sind verloren!“ Wir sind verloren! Ende!"
Dennoch verlor er nicht den Kopf, beobachtete aufmerksam die Arbeit der Matrosen und ergriff alle Maßnahmen, um sein Schiff zu retten.
Bisher hatte ich keine Angst verspürt: Ich war mir sicher, dass dieser Sturm genauso sicher vorübergehen würde wie der erste. Doch als der Kapitän selbst verkündete, dass das Ende für uns alle gekommen sei, bekam ich schreckliche Angst und rannte aus der Kabine auf das Deck. Noch nie in meinem Leben habe ich einen so schrecklichen Anblick gesehen. Riesige Wellen bewegten sich wie hohe Berge über das Meer, und alle drei oder vier Minuten stürzte ein solcher Berg auf uns.
Zuerst war ich taub vor Angst und konnte mich nicht umsehen. Als ich es endlich wagte, zurückzublicken, wurde mir klar, was für eine Katastrophe über uns hereingebrochen war. Auf zwei schwer beladenen Schiffen, die in der Nähe vor Anker lagen, schnitten die Matrosen die Masten ab, um die Schiffe zumindest ein wenig von ihrem Gewicht zu entlasten.
Zwei weitere Schiffe verloren ihre Anker und wurden vom Sturm aufs Meer hinausgetragen. Was erwartete sie dort? Alle ihre Masten wurden durch den Hurrikan umgeworfen.
Kleinere Schiffe hielten sich besser, aber einige von ihnen mussten auch leiden: Zwei oder drei Boote trieben an unserer Seite vorbei direkt ins offene Meer.
Am Abend kamen der Navigator und der Bootsmann zum Kapitän und sagten ihm, dass es zur Rettung des Schiffes notwendig sei, den Fockmast abzuschneiden 1
Der Fockmast ist der vordere Mast.
– Sie können keine Minute zögern! - Sie sagten. - Geben Sie die Bestellung auf und wir werden sie kürzen.
„Wir warten noch etwas“, wandte der Kapitän ein. „Vielleicht lässt der Sturm nach.“
Eigentlich wollte er den Mast nicht durchtrennen, aber der Bootsmann begann zu argumentieren, dass das Schiff sinken würde, wenn der Mast übrig bliebe – und der Kapitän stimmte widerwillig zu.
Und wenn sie den Fockmast abschneiden, den Großmast 2
Der Hauptmast ist ein mittlerer Mast.
Es begann so stark zu schwanken und das Schiff zu schaukeln, dass es ebenfalls abgeholzt werden musste.
Die Nacht brach herein, und plötzlich schrie einer der Matrosen, als er in den Laderaum hinabstieg, dass das Schiff ein Leck gehabt habe. Ein anderer Seemann wurde in den Laderaum geschickt und berichtete, dass das Wasser bereits einen Meter gestiegen sei 3
Ein Fuß ist eine englische Längeneinheit, etwa ein Drittel Meter.
Dann befahl der Kapitän:
- Wasser abpumpen! Alles an die Pumpen 4
Pumpe – eine Pumpe zum Abpumpen von Wasser.
Als ich diesen Befehl hörte, sank mein Herz vor Entsetzen: Es kam mir vor, als würde ich sterben, meine Beine gaben nach und ich fiel rücklings auf das Bett. Aber die Matrosen drängten mich beiseite und forderten, dass ich mich meiner Arbeit nicht entziehen sollte.
- Du warst genug untätig, jetzt ist es Zeit, hart zu arbeiten! - Sie sagten.
Es gab nichts zu tun, ich ging zur Pumpe und begann fleißig Wasser abzupumpen.
Zu dieser Zeit lichteten kleine Frachtschiffe, die dem Wind nicht widerstehen konnten, die Anker und fuhren aufs offene Meer hinaus.
Als unser Kapitän sie sah, befahl er, die Kanone abzufeuern, um ihnen mitzuteilen, dass wir in Lebensgefahr schwebten. Als ich eine Kanonensalve hörte und nicht verstand, was geschah, stellte ich mir vor, dass unser Schiff abgestürzt sei. Ich hatte solche Angst, dass ich ohnmächtig wurde und fiel. Aber damals war jeder besorgt, sein eigenes Leben zu retten, und sie schenkten mir keine Beachtung. Niemand war daran interessiert herauszufinden, was mit mir passiert ist. An meiner Stelle stand einer der Matrosen an der Pumpe und schob mich mit dem Fuß beiseite. Alle waren sich sicher, dass ich bereits tot war. Ich lag sehr lange so da. Als ich aufwachte, machte ich mich wieder an die Arbeit. Wir arbeiteten unermüdlich, doch das Wasser im Laderaum stieg immer höher.
Es war klar, dass das Schiff sinken würde. Zwar begann der Sturm etwas nachzulassen, aber wir hatten nicht die geringste Möglichkeit, bis zur Einfahrt in den Hafen auf dem Wasser zu bleiben. Deshalb hörte der Kapitän nicht auf, seine Kanonen abzufeuern, in der Hoffnung, dass uns jemand vor dem Tod retten würde.
Schließlich wagte das kleine Schiff, das uns am nächsten war, das Risiko, ein Boot herabzulassen, um uns zu helfen. Das Boot hätte jede Minute kentern können, aber es kam trotzdem auf uns zu. Leider konnten wir nicht hinein, da es keine Möglichkeit gab, an unserem Schiff festzumachen, obwohl die Menschen mit aller Kraft ruderten und ihr Leben riskierten, um unseres zu retten. Wir warfen ihnen ein Seil zu. Sie konnten ihn lange Zeit nicht einholen, da der Sturm ihn zur Seite riss. Doch zum Glück gelang es einem der Draufgänger, sich nach vielen erfolglosen Versuchen das Seil am Ende zu schnappen. Dann zogen wir das Boot unter unser Heck und jeder einzelne von uns stieg hinein. Wir wollten zu ihrem Schiff, aber wir konnten den Wellen nicht widerstehen und die Wellen trugen uns ans Ufer. Es stellte sich heraus, dass dies die einzige Richtung war, in die man rudern konnte. Es verging keine Viertelstunde, bis unser Schiff im Wasser zu versinken begann. Die Wellen, die unser Boot hin und her trieben, waren so hoch, dass wir das Ufer nicht sehen konnten. Erst in dem ganz kurzen Moment, als unser Boot auf dem Wellenkamm hochgeworfen wurde, konnten wir erkennen, dass sich eine große Menschenmenge am Ufer versammelt hatte: Menschen rannten hin und her und bereiteten sich darauf vor, uns zu helfen, wenn wir näher kamen. Aber wir bewegten uns sehr langsam in Richtung Ufer. Erst am Abend gelang es uns, an Land zu gelangen, und selbst dann unter größten Schwierigkeiten.
Wir mussten nach Yarmouth laufen. Dort erwartete uns ein herzlicher Empfang: Die Einwohner der Stadt, die bereits von unserem Unglück wussten, gaben uns eine gute Unterkunft, bewirteten uns mit einem hervorragenden Abendessen und versorgten uns mit Geld, damit wir dorthin gelangen konnten, wohin wir wollten – nach London oder nach Hull .
Nicht weit von Hull entfernt lag York, wo meine Eltern lebten, und natürlich hätte ich zu ihnen zurückkehren sollen. Sie würden mir meine unerlaubte Flucht verzeihen und wir wären alle so glücklich!
Aber der verrückte Traum von Seeabenteuern ließ mich auch jetzt noch nicht los. Obwohl mir die nüchterne Stimme der Vernunft sagte, dass mich auf See neue Gefahren und Probleme erwarteten, begann ich erneut darüber nachzudenken, wie ich auf ein Schiff steigen und die Meere und Ozeane der ganzen Welt bereisen könnte.
Mein Freund (derselbe, dessen Vater das verlorene Schiff besaß) war jetzt düster und traurig. Die Katastrophe, die passierte, deprimierte ihn. Er stellte mich seinem Vater vor, der ebenfalls nicht aufhörte, über das gesunkene Schiff zu trauern. Nachdem er von meinem Sohn von meiner Leidenschaft für Seereisen erfahren hatte, sah mich der alte Mann streng an und sagte:
„Junger Mann, du solltest nie wieder zur See fahren.“ Ich habe gehört, dass du feige und verwöhnt bist und bei der geringsten Gefahr den Mut verlierst. Solche Leute sind nicht geeignet, Seeleute zu sein. Kehren Sie schnell nach Hause zurück und versöhnen Sie sich mit Ihrer Familie. Sie haben aus erster Hand erfahren, wie gefährlich es ist, auf dem Seeweg zu reisen.
Ich hatte das Gefühl, dass er Recht hatte und konnte nichts dagegen haben. Trotzdem kehrte ich nicht nach Hause zurück, weil ich mich schämte, vor meinen Lieben zu erscheinen. Es schien mir, als würden alle unsere Nachbarn mich verspotten; Ich war mir sicher, dass meine Misserfolge mich zum Gespött aller meiner Freunde und Bekannten machen würden. In der Folge ist mir oft aufgefallen, dass Menschen, insbesondere in ihrer Jugend, nicht die skrupellosen Taten für beschämend halten, für die wir sie Narren nennen, sondern die guten und edlen Taten, die sie in Momenten der Reue begehen, obwohl sie nur für diese Taten als vernünftig bezeichnet werden können . So war ich damals. Die Erinnerungen an das Unglück, das ich während des Schiffbruchs erlebte, verblassten allmählich, und nachdem ich zwei oder drei Wochen in Yarmouth gelebt hatte, ging ich nicht nach Hull, sondern nach London.
Kapitel 3
Robinson wird gefangen genommen. - Flucht
Mein großes Unglück war, dass ich bei all meinen Abenteuern nicht als Seemann an Bord des Schiffes war. Zwar müsste ich mehr arbeiten, als ich es gewohnt bin, aber am Ende würde ich Seemannschaft lernen und könnte irgendwann Navigator und vielleicht sogar Kapitän werden. Aber ich war damals so unvernünftig, dass ich von allen Wegen immer den schlechtesten gewählt habe. Da ich damals schick gekleidet war und Geld in der Tasche hatte, kam ich immer als Faulenzer auf das Schiff: Ich habe dort nichts getan und nichts gelernt.
Junge Wildfang- und Faulenzer geraten meist in schlechte Gesellschaft und verirren sich innerhalb kürzester Zeit völlig. Das gleiche Schicksal erwartete mich, aber glücklicherweise gelang es mir bei meiner Ankunft in London, einen angesehenen älteren Kapitän zu treffen, der eine große Anteilnahme an mir hatte. Kurz zuvor segelte er mit seinem Schiff an die Küste Afrikas, nach Guinea. Diese Reise brachte ihm beträchtlichen Gewinn, und nun wollte er erneut in die gleiche Region reisen.
Er mochte mich, weil ich damals ein guter Gesprächspartner war. Er verbrachte oft seine Freizeit mit mir und als er erfuhr, dass ich überseeische Länder sehen wollte, lud er mich ein, mit seinem Schiff in See zu stechen.
„Es wird dich nichts kosten“, sagte er, „Ich werde kein Geld von dir für Reisen oder Essen nehmen.“ Du wirst mein Gast auf dem Schiff sein. Wenn Sie einige Dinge mitnehmen und es schaffen, diese in Guinea sehr gewinnbringend zu verkaufen, erhalten Sie den gesamten Gewinn. Versuchen Sie Ihr Glück – vielleicht haben Sie Glück.
Da dieser Kapitän das allgemeine Vertrauen genoss, nahm ich seine Einladung gerne an.
Als ich nach Guinea ging, nahm ich einige Waren mit: Ich kaufte vierzig Pfund Sterling 5
Pfund Sterling ist englisches Geld, etwa zehn Rubel in Gold.
Verschiedene Schmuckstücke und Glasgegenstände, die bei Wilden guten Verkauf fanden.
Diese vierzig Pfund erhielt ich mit der Hilfe naher Verwandter, mit denen ich in Briefwechsel stand: Ich teilte ihnen mit, dass ich Handel treiben würde, und sie überredeten meine Mutter und vielleicht auch meinen Vater, mir zumindest mit einem kleinen Betrag zu helfen in meinem ersten Unternehmen.
Diese Reise nach Afrika war sozusagen meine einzige erfolgreiche Reise. Natürlich verdankte ich meinen Erfolg ausschließlich der Selbstlosigkeit und Freundlichkeit des Kapitäns.
Während der Reise lernte er bei mir Mathematik und brachte mir Schiffbau bei. Es hat ihm Spaß gemacht, seine Erfahrungen mit mir zu teilen, und ich habe es genossen, ihm zuzuhören und von ihm zu lernen.
Die Reise machte mich sowohl zum Seemann als auch zum Kaufmann: Ich tauschte fünf Pfund und neun Unzen gegen meinen Schmuck 6
Das sind etwa zweieinhalb Kilogramm.
Goldsand, für den er nach seiner Rückkehr nach London eine stattliche Summe erhielt.
Doch zu meinem Unglück starb mein Freund, der Kapitän, kurz nach meiner Rückkehr nach England, und ich war gezwungen, eine zweite Reise alleine zu unternehmen, ohne freundlichen Rat und Hilfe.
Ich bin mit demselben Schiff von England aus gesegelt. Es war die elendste Reise, die der Mensch je unternommen hat.
Eines Tages im Morgengrauen, als wir nach einer langen Reise zwischen den Kanarischen Inseln und Afrika unterwegs waren, wurden wir von Piraten – Seeräubern – angegriffen. Das waren Türken aus Saleh. Sie bemerkten uns schon von weitem und machten sich mit vollen Segeln auf den Weg zu uns.
Wir hofften zunächst, dass wir ihnen durch die Flucht entkommen könnten, und setzten auch alle Segel. Aber es wurde schnell klar, dass sie uns in fünf oder sechs Stunden sicherlich einholen würden. Uns wurde klar, dass wir uns auf den Kampf vorbereiten mussten. Wir hatten zwölf Kanonen und der Feind hatte achtzehn.
Gegen drei Uhr nachmittags holte uns das Räuberschiff ein, doch die Piraten machten einen großen Fehler: Statt uns vom Heck zu nähern, näherten sie sich uns von der Backbordseite, wo wir acht Kanonen hatten. Wir nutzten ihren Fehler aus, richteten all diese Waffen auf sie und feuerten eine Salve ab.
Es waren mindestens zweihundert Türken, also antworteten sie auf unser Feuer nicht nur mit Kanonen, sondern auch mit einer Waffensalve von zweihundert Kanonen.
Glücklicherweise wurde niemand getroffen, alle blieben gesund und munter. Nach diesem Kampf zog sich das Piratenschiff eine halbe Meile zurück 7
Eine Meile ist ein Längenmaß, etwa 1609 Meter.
Und sie begannen, sich auf einen neuen Angriff vorzubereiten. Wir haben uns unsererseits auf eine neue Verteidigung vorbereitet.
Diesmal kamen die Feinde von der anderen Seite auf uns zu und enterten uns, das heißt, sie hingen mit Haken an unserer Seite fest; Ungefähr sechzig Leute stürmten auf das Deck und beeilten sich zunächst, die Masten und das Gerät zu zerschneiden.
Wir begegneten ihnen mit Gewehrfeuer und räumten zweimal das Deck von ihnen, mussten uns aber dennoch ergeben, da unser Schiff nicht mehr für eine weitere Reise geeignet war. Drei unserer Männer wurden getötet und acht verletzt. Wir wurden als Gefangene in die Hafenstadt Saleh gebracht, die den Mauren gehörte 8
Mauren – hier: nordafrikanische muslimische Araber.
Die anderen Engländer wurden ins Landesinnere geschickt, an den Hof des grausamen Sultans, aber der Kapitän des Räuberschiffs behielt mich bei sich und machte ihn zu seinem Sklaven, weil ich jung und flink war.
Ich weinte bitterlich: Ich erinnerte mich an die Vorhersage meines Vaters, dass mir früher oder später Ärger passieren würde und mir niemand zu Hilfe kommen würde. Ich dachte, dass ich es war, der solch ein Unglück erlitten hatte. Leider hatte ich keine Ahnung, dass noch schlimmere Probleme bevorstehen.
Da mich mein neuer Herr, der Kapitän des Räuberschiffs, bei sich gelassen hatte, hoffte ich, dass er mich mitnehmen würde, wenn er erneut Seeschiffe ausrauben würde. Ich war fest davon überzeugt, dass er am Ende von einem spanischen oder portugiesischen Kriegsschiff gefangen genommen werden würde und ich dann meine Freiheit zurückerhalten würde.
Doch bald wurde mir klar, dass diese Hoffnungen vergebens waren, denn als mein Herr zum ersten Mal zur See fuhr, ließ er mich zu Hause, um die niedere Arbeit zu erledigen, die Sklaven normalerweise verrichten.
Von diesem Tag an dachte ich nur noch an Flucht. Aber es war unmöglich zu entkommen: Ich war allein und machtlos. Unter den Gefangenen gab es keinen einzigen Engländer, dem ich vertrauen konnte. Ich schmachtete zwei Jahre lang in Gefangenschaft, ohne die geringste Hoffnung auf Flucht. Aber im dritten Jahr gelang mir trotzdem die Flucht. Es ist so passiert. Mein Herr fuhr ständig, ein- oder zweimal in der Woche, mit einem Schiff an die Küste, um zu fischen. Auf jeder dieser Reisen nahm er mich und einen Jungen mit, der Xuri hieß. Wir ruderten fleißig und unterhielten unseren Meister, so gut wir konnten. Und da ich mich außerdem als guter Fischer erwies, schickte er uns beide – mich und diesen Xuri – manchmal zum Fischen unter der Aufsicht eines alten Mauren, seines entfernten Verwandten.
Eines Tages lud mein Herr zwei sehr bedeutende Mauren ein, mit ihm auf seinem Segelboot zu fahren. Für diese Reise bereitete er große Vorräte an Lebensmitteln vor, die er abends auf sein Boot schickte. Das Boot war geräumig. Der Eigner befahl vor zwei Jahren seinem Schiffsschreiner, darin eine kleine Kabine und in der Kabine eine Speisekammer für Proviant zu bauen. Ich habe alle meine Vorräte in dieser Speisekammer untergebracht.
„Vielleicht wollen die Gäste jagen“, sagte mir der Besitzer. - Nehmen Sie drei Kanonen vom Schiff und bringen Sie sie zum Boot.
Ich tat alles, was mir befohlen wurde: Ich wusch das Deck, hisste die Flagge am Mast und saß am nächsten Morgen im Boot und wartete auf Gäste. Plötzlich kam der Besitzer allein und sagte, dass seine Gäste heute nicht gehen würden, da sie sich aus geschäftlichen Gründen verspäteten. Dann befahl er uns dreien – mir, dem Jungen Xuri und dem Mauren –, mit unserem Boot zum Meeresufer zu fahren, um dort Fische zu fangen.
„Meine Freunde werden mit mir zum Abendessen kommen“, sagte er, „Sobald Sie also genug Fisch gefangen haben, bringen Sie ihn hierher.“
Da erwachte in mir wieder der alte Traum von der Freiheit. Jetzt hatte ich ein Schiff, und sobald der Besitzer weg war, begann ich mit den Vorbereitungen – nicht für den Fischfang, sondern für eine lange Reise. Ich wusste zwar nicht, wohin ich meinen Weg führen sollte, aber jeder Weg ist gut – solange er die Flucht aus der Gefangenschaft bedeutet.
„Wir sollten uns etwas zu essen besorgen“, sagte ich zum Mauren. „Wir können das Essen, das der Besitzer für die Gäste zubereitet hat, nicht ungefragt essen.“
Der alte Mann stimmte mir zu und brachte bald einen großen Korb mit Semmelbröseln und drei Krüge mit frischem Wasser.
Ich wusste, wo der Besitzer eine Kiste Wein hatte, und während der Maure Proviant holte, transportierte ich alle Flaschen zum Boot und stellte sie in die Speisekammer, als ob sie zuvor für den Besitzer gelagert worden wären.
Außerdem brachte ich ein riesiges Stück Wachs mit (fünfzig Pfund schwer) und schnappte mir einen Knäuel Garn, eine Axt, eine Säge und einen Hammer. All dies war später für uns sehr nützlich, insbesondere das Wachs, aus dem wir Kerzen hergestellt haben.
Ich habe mir einen weiteren Trick ausgedacht und wieder gelang es mir, den einfältigen Mauren zu täuschen. Sein Name war Ismael, deshalb nannten ihn alle Moli. Also sagte ich ihm:
- Beten Sie, auf dem Schiff sind die Jagdgewehre des Besitzers. Es wäre schön, etwas Schießpulver und ein paar Ladungen zu besorgen – vielleicht haben wir das Glück, zum Abendessen ein paar Watvögel zu erschießen. Ich weiß, dass der Besitzer Schießpulver und Schüsse auf dem Schiff aufbewahrt.
„Okay“, sagte er, „ich bringe es.“
Und er brachte eine große Ledertasche mit Schießpulver – eineinhalb Pfund schwer, vielleicht auch mehr – und eine weitere mit Schrot – fünf oder sechs Pfund. Er nahm auch die Kugeln ab. All dies wurde im Boot aufbewahrt. Außerdem befand sich in der Kapitänskajüte noch etwas Schießpulver, das ich in eine große Flasche füllte, nachdem ich zuvor den restlichen Wein ausgeschüttet hatte.
Nachdem wir uns mit allem Notwendigen für eine lange Reise eingedeckt hatten, verließen wir den Hafen wie zum Angeln. Ich habe meine Angelruten ins Wasser gesteckt, aber nichts gefangen (ich habe meine Angelruten absichtlich nicht herausgezogen, als der Fisch am Haken war).
„Wir werden hier nichts fangen!“ - Ich sagte zum Mauren. „Der Besitzer wird uns nicht loben, wenn wir mit leeren Händen zu ihm zurückkehren.“ Wir müssen weiter aufs Meer hinaus vordringen. Vielleicht beißt der Fisch abseits des Ufers besser zu.
Der alte Maure ahnte keine Täuschung, stimmte mir zu und hob, da er am Bug stand, das Segel.
Ich saß am Steuer, am Heck, und als das Schiff etwa drei Meilen auf das offene Meer hinausfuhr, begann ich zu treiben 9
Driften bedeutet, die Segel so auf dem Boot zu positionieren, dass es nahezu bewegungslos bleibt.
- als wollte ich wieder mit dem Angeln beginnen. Dann übergab ich dem Jungen das Steuerrad, stieg auf den Bug, näherte mich dem Mauren von hinten, hob ihn plötzlich hoch und warf ihn ins Meer. Er tauchte sofort wieder auf, denn er schwebte wie ein Korken, und rief mir zu, ich solle ihn ins Boot nehmen, und versprach, dass er mit mir bis ans Ende der Welt fahren würde. Er schwamm so schnell hinter dem Schiff her, dass er mich sehr bald eingeholt hätte (der Wind war schwach und das Boot bewegte sich kaum). Da ich sah, dass der Maure uns bald überholen würde, rannte ich zur Hütte, nahm eines der Jagdgewehre dort, zielte auf den Mauren und sagte:
„Ich wünsche dir nichts Böses, aber lass mich jetzt in Ruhe und komm schnell nach Hause!“ Du bist ein guter Schwimmer, das Meer ist ruhig, du kannst problemlos bis zum Ufer schwimmen. Dreh dich um und ich werde dich nicht berühren. Aber wenn du das Boot nicht verlässt, schieße ich dir in den Kopf, weil ich entschlossen bin, meine Freiheit zu gewinnen.
Er wandte sich dem Ufer zu und schwamm sicher ohne Schwierigkeiten dorthin.
Natürlich könnte ich diesen Mauren mitnehmen, aber auf den alten Mann war kein Verlass.
Als der Mohr hinter das Boot fiel, drehte ich mich zu dem Jungen um und sagte:
- Xuri, wenn du mir treu bist, werde ich dir viel Gutes tun. Schwöre, dass du mich niemals betrügen wirst, sonst werde ich dich auch ins Meer werfen.
Der Junge lächelte, sah mir direkt in die Augen und schwor, dass er mir bis zum Grab treu bleiben und mit mir gehen würde, wohin ich wollte. Er sprach so aufrichtig, dass ich nicht anders konnte, als ihm zu glauben.
Bis sich das Moor der Küste näherte, hielt ich Kurs auf das offene Meer und kreuzte gegen den Wind, damit jeder dachte, wir würden nach Gibraltar fahren.
Doch sobald es anfing zu dämmern, begann ich nach Süden zu steuern und hielt mich dabei leicht nach Osten, weil ich mich nicht von der Küste entfernen wollte. Es wehte ein sehr frischer Wind, aber das Meer war flach und ruhig, und deshalb kamen wir in gutem Tempo voran.
Als am nächsten Tag um drei Uhr zum ersten Mal Land vor uns auftauchte, befanden wir uns bereits anderthalbhundert Meilen südlich von Saleh, weit jenseits der Grenzen der Besitztümer des marokkanischen Sultans und überhaupt aller anderen Afrikanischer König. Das Ufer, dem wir uns näherten, war völlig menschenleer. Aber in der Gefangenschaft bekam ich solche Angst und fürchtete mich so vor einer erneuten Gefangennahme durch die Mauren, dass ich den günstigen Wind ausnutzte, der mein Boot nach Süden trieb, und fünf Tage lang immer weiter segelte, ohne vor Anker zu gehen oder an Land zu gehen.
Fünf Tage später änderte sich der Wind: Er wehte aus Süden, und da ich keine Angst mehr vor einer Verfolgung hatte, beschloss ich, mich dem Ufer zu nähern und an der Mündung eines kleinen Flusses vor Anker zu gehen. Ich kann nicht sagen, um was für einen Fluss es sich handelt, wo er fließt und was für Menschen an seinen Ufern leben. Seine Ufer waren verlassen, und das freute mich sehr, da ich keine Lust hatte, Menschen zu sehen. Das Einzige, was ich brauchte, war frisches Wasser.
Wir betraten die Mündung am Abend und beschlossen, als es dunkel wurde, an Land zu schwimmen und die gesamte Umgebung zu untersuchen. Doch sobald es dunkel wurde, hörten wir schreckliche Geräusche vom Ufer: Am Ufer wimmelte es von Tieren, die so wütend heulten, knurrten, brüllten und bellten, dass der arme Xuri vor Angst fast starb und mich anflehte, bis dahin nicht an Land zu gehen Morgen.
„Okay, Xuri“, sagte ich zu ihm, „lass uns warten!“ Aber vielleicht werden wir bei Tageslicht Menschen sehen, unter denen wir vielleicht noch schlimmer leiden werden als unter den wilden Tigern und Löwen.
„Und wir werden diese Leute mit einer Waffe erschießen“, sagte er lachend, „und sie werden weglaufen!“
Ich war froh, dass sich der Junge gut benahm. Damit er in Zukunft nicht entmutigt wird, schenkte ich ihm einen Schluck Wein.
Ich befolgte seinen Rat und wir blieben die ganze Nacht vor Anker, ohne das Boot zu verlassen und unsere Waffen bereitzuhalten. Wir mussten bis zum Morgen kein Auge zudrücken.
Zwei oder drei Stunden nachdem wir vor Anker gegangen waren, hörten wir das schreckliche Brüllen einiger riesiger Tiere einer sehr seltsamen Rasse (wir wussten selbst nicht was). Die Tiere näherten sich dem Ufer, betraten den Fluss, begannen darin zu planschen und sich zu suhlen, offensichtlich wollten sie sich erfrischen, und gleichzeitig kreischten, brüllten und heulten sie; So widerliche Geräusche hatte ich noch nie zuvor gehört.
Xuri zitterte vor Angst; Ehrlich gesagt hatte ich auch Angst.
Aber wir hatten beide noch mehr Angst, als wir hörten, dass eines der Monster auf unser Schiff zuschwamm. Wir konnten es nicht sehen, aber wir hörten es nur schnaufen und schnauben, und allein anhand dieser Geräusche schlossen wir, dass das Monster riesig und wild war.
„Es muss ein Löwe sein“, sagte Xuri. - Lasst uns den Anker lichten und hier verschwinden!
„Nein, Xuri“, wandte ich ein, „wir haben keinen Grund, den Anker zu lichten.“ Wir lassen das Seil einfach länger laufen und bewegen uns weiter hinaus ins Meer – die Tiere werden uns nicht verfolgen.
Aber sobald ich diese Worte sagte, sah ich ein unbekanntes Tier in einer Entfernung von zwei Rudern von unserem Schiff. Ich war etwas verwirrt, aber ich nahm sofort eine Waffe aus der Kabine und feuerte. Das Tier drehte sich um und schwamm zum Ufer.

Es ist unmöglich, das wütende Brüllen zu beschreiben, das am Ufer entstand, als mein Schuss fiel: Die Tiere hier dürften dieses Geräusch noch nie zuvor gehört haben. Hier war ich schließlich davon überzeugt, dass es unmöglich war, nachts an Land zu gehen. Aber ob es überhaupt möglich wäre, tagsüber zu landen – auch das wussten wir nicht. Opfer eines Wilden zu werden ist nicht besser, als in die Klauen eines Löwen oder Tigers zu fallen.
Aber wir mussten unbedingt hier oder anderswo an Land gehen, da wir keinen Tropfen Wasser mehr hatten. Wir waren schon lange durstig. Endlich kam der lang erwartete Morgen. Xuri sagte, wenn ich ihn gehen ließe, würde er zum Ufer waten und versuchen, frisches Wasser zu bekommen. Und als ich ihn fragte, warum er gehen sollte und nicht ich, antwortete er:
„Wenn ein wilder Mann kommt, wird er mich fressen und du wirst am Leben bleiben.“
Diese Antwort drückte eine solche Liebe zu mir aus, dass ich tief berührt war.
„Das ist es, Xuri“, sagte ich, „wir gehen beide.“ Und wenn ein wilder Mann kommt, werden wir ihn erschießen, und er wird weder dich noch mich fressen.
Ich gab dem Jungen ein paar Cracker und einen Schluck Wein; Dann zogen wir uns näher an den Boden heran, sprangen ins Wasser und wateten zum Ufer, wobei wir nichts als Waffen und zwei leere Wasserkrüge mitnahmen.
Ich wollte mich nicht vom Ufer entfernen, um unser Schiff nicht aus den Augen zu verlieren.
Ich hatte Angst, dass sie mit ihren Pirogen den Fluss hinunter zu uns kommen könnten 10
Eine Piroge ist ein langes Boot, das aus einem Baumstamm ausgehöhlt ist.
Wilde. Aber Ksuri, der eine Meile vom Ufer entfernt eine Mulde bemerkte, stürzte mit dem Krug dorthin.
Plötzlich sehe ich ihn zurücklaufen. „Haben die Wilden ihn verfolgt? – Dachte ich voller Angst. „Hatte er Angst vor einem Raubtier?“
Ich eilte ihm zu Hilfe und als ich näher rannte, sah ich, dass etwas Großes hinter seinem Rücken hing. Es stellte sich heraus, dass er ein Tier wie unseren Hasen getötet hatte, nur dass sein Fell eine andere Farbe hatte und seine Beine länger waren. Wir waren beide froh über dieses Spiel, aber ich freute mich noch mehr, als Xury mir erzählte, dass er in der Mulde viel gutes Süßwasser gefunden hatte.
Nachdem wir die Krüge gefüllt hatten, frühstückten wir ausgiebig mit dem getöteten Tier und machten uns auf den Weg zu unserer weiteren Reise. Wir haben also in diesem Bereich keine Spuren von Menschen gefunden.
Nachdem wir die Flussmündung verlassen hatten, musste ich während unserer weiteren Reise mehrmals am Ufer anlegen, um frisches Wasser zu holen.
„ROBINSON CRUSOE. 02.“
ROBINSON CRUSOE.
TEIL EINS
Ich wurde 1632 in der Stadt York in eine wohlhabende Familie ausländischer Herkunft geboren. Mein Vater stammte aus Bremen und ließ sich zunächst in Hull nieder. Nachdem er durch Handel ein großes Vermögen gemacht hatte, gab er sein Geschäft auf und zog nach York. Hier heiratete er meine Mutter, deren Verwandte Robinsons hießen – ein alter Familienname an diesen Orten. Nach ihnen nannten sie mich Robinson. Der Nachname meines Vaters war Kreutzner, aber nach dem englischen Brauch, Fremdwörter zu verfälschen, begannen sie, uns Crusoe zu nennen. Jetzt sprechen und schreiben wir selbst unseren Nachnamen auf diese Weise; So haben mich meine Freunde auch immer genannt.
Ich hatte zwei ältere Brüder. Einer diente in Flandern in einem englischen Infanterieregiment, dem gleichen, das einst vom berühmten Colonel Lockhart kommandiert wurde; er stieg bis zum Oberstleutnant auf und fiel im Gefecht mit den Spaniern bei Dunkirchen. Ich weiß nicht, was mit meinem zweiten Bruder passiert ist, genauso wie mein Vater und meine Mutter nicht wussten, was mit mir passiert ist.
Da ich der Dritte in der Familie war, war ich auf kein Handwerk vorbereitet und mein Kopf war schon in jungen Jahren voller Unsinn. Mein Vater, der bereits sehr alt war, ermöglichte mir eine einigermaßen erträgliche Ausbildung, die man durch das Aufwachsen zu Hause und den Besuch einer städtischen Schule erreichen kann. Er wollte, dass ich Anwalt werde, aber ich träumte von Seereisen und wollte nichts anderes hören. Diese Leidenschaft für das Meer trieb mich so weit, dass ich gegen meinen Willen handelte – mehr noch: gegen das direkte Verbot meines Vaters und die Bitten meiner Mutter und den Rat von Freunden ignorierte; Es schien, als ob in der natürlichen Anziehung, die mich zu dem traurigen Leben trieb, das mein Los war, etwas Verhängnisvolles lag.
Mein Vater, ein ruhiger und intelligenter Mann, erriet meine Idee und warnte mich ernsthaft und gründlich. Eines Morgens rief er mich in sein Zimmer, in das er wegen Gicht eingesperrt war, und begann mich heftig zu tadeln. Er fragte, welche anderen Gründe ich außer den Neigungen zum Vagabunden haben könnte, das Haus meines Vaters und mein Heimatland zu verlassen, wo es mir leicht fällt, zu den Menschen zu gehen, wo ich mein Vermögen durch Fleiß und Arbeit vermehren und in Zufriedenheit leben und leben kann Vergnügen. Sie verlassen ihre Heimat auf der Suche nach Abenteuern, sagte er. oder diejenigen, die nichts zu verlieren haben, oder ehrgeizige Menschen, die sich eine höhere Position aufbauen wollen; Indem sie sich auf Unternehmungen einlassen, die über den Rahmen des Alltagslebens hinausgehen, streben sie danach, die Dinge zu verbessern und ihren Namen mit Ruhm zu bedecken. aber solche Dinge liegen entweder außerhalb meiner Macht oder sind demütigend für mich; Mein Platz ist die Mitte, also das, was man die höchste Stufe des bescheidenen Daseins nennen kann, die, wie er aus langjähriger Erfahrung überzeugt war, für uns die beste der Welt ist, die geeignetste für das menschliche Glück, befreit von Sowohl Bedürftigkeit als auch Entbehrung, körperliche Arbeit und Leiden fallen den unteren Klassen zu und aus Luxus, Ehrgeiz, Arroganz und Neid fallen die oberen Klassen. Wie angenehm ein solches Leben ist, sagte er, kann ich daran erkennen, dass jeder, der sich in unterschiedlichen Verhältnissen befindet, ihn beneidet: Sogar Könige beschweren sich oft über das bittere Schicksal von Menschen, die für große Taten geboren wurden, und bedauern, dass das Schicksal sie nicht zwischen zwei gestellt hat Extreme - Bedeutungslosigkeit und Größe, und der Weise spricht sich für die Mitte als Maß für wahres Glück aus, wenn er zum Himmel betet, ihm weder Armut noch Reichtum zu schicken.
Ich muss nur beobachten, sagte mein Vater, und ich werde dafür sorgen, dass alle Nöte des Lebens zwischen der höheren und der unteren Klasse verteilt werden und dass sie am allerwenigsten den Menschen mit durchschnittlichem Vermögen zufallen, die ihnen nicht unterworfen sind so viele Schicksalsschläge wie der Adel und das einfache Volk; Selbst gegen körperliche und geistige Krankheiten sind sie besser abgesichert als diejenigen, deren Krankheiten durch Laster, Luxus und alle Arten von Exzessen einerseits, harte Arbeit, Not, schlechte und unzureichende Ernährung andererseits verursacht werden und somit natürlich sind Folge des Lebensstils. Der mittlere Zustand ist der günstigste für das Gedeihen aller Tugenden, aller Lebensfreuden; Fülle und Frieden sind seine Diener; Er wird begleitet und gesegnet von seiner Mäßigung, Mäßigkeit, Gesundheit, seinem Seelenfrieden, seiner Geselligkeit, allen Arten angenehmer Unterhaltung und allen Arten von Freuden. Ein durchschnittlich wohlhabender Mensch geht seinen Lebensweg ruhig und reibungslos, ohne sich mit körperlicher oder geistiger Knochenarbeit zu belasten, ohne für ein Stück Brot in die Sklaverei verkauft zu werden, ohne sich auf der Suche nach einem Ausweg aus komplizierten, entbehrungsreichen Situationen zu quälen sein Körper schläft und seine Seele friedvoll, und er wird nicht von Neid verzehrt, ohne heimlich mit dem Feuer des Ehrgeizes zu brennen. Umgeben von Zufriedenheit gleitet er leicht und unmerklich dem Grab entgegen, genießt die Süßigkeiten des Lebens ohne eine Beimischung von Bitterkeit, fühlt sich glücklich und lernt durch alltägliche Erfahrungen, dies klarer und tiefer zu verstehen.
Dann fing mein Vater beharrlich und sehr wohlwollend an, mich zu bitten, nicht kindisch zu sein, nicht kopfüber in den Strudel der Not und des Leidens zu stürzen, vor dem mich die Stellung, die ich von Geburt an in der Welt einnahm, anscheinend hätte schützen sollen. Er sagte, dass ich nicht gezwungen sei, für ein Stück Brot zu arbeiten, dass er sich um mich kümmern würde, versuchen würde, mich auf den Weg zu führen, den er mir gerade geraten hatte, und dass, wenn ich mich als Versager erweisen sollte oder unglücklich, ich müsste nur das Pech oder deinen eigenen Fehler dafür verantwortlich machen. Indem er mich vor einem Schritt warnt, der mir nur Schaden bringt, erfüllt er damit seine Pflicht und verzichtet auf jede Verantwortung; Mit einem Wort: Wenn ich zu Hause bleibe und mein Leben nach seinen Anweisungen gestalte, wird er mir ein guter Vater sein, aber an meinem Tod wird er nicht beteiligt sein und mich ermutigen, zu gehen. Abschließend nannte er mir das Beispiel meines älteren Bruders, den er ebenfalls beharrlich davon überzeugte, nicht am niederländischen Krieg teilzunehmen, doch all seine Überredungen waren vergebens: Von seinen Träumen mitgerissen, floh der junge Mann zur Armee und wurde getötet. Und obwohl er (so beendete mein Vater seine Rede) niemals aufhören wird, für mich zu beten, sagt er mir direkt, dass ich Gottes Segen nicht erhalten werde, wenn ich meine verrückte Idee nicht aufgebe. Die Zeit wird kommen, in der ich bereuen werde, dass ich seinen Rat vernachlässigt habe, aber dann wird es vielleicht niemanden mehr geben, der mir hilft, das Unrecht, das ich getan habe, zu korrigieren.
Ich sah, wie während des letzten Teils dieser Rede (die wirklich prophetisch war, obwohl mein Vater selbst es, glaube ich, nicht vermutet hatte) reichlich Tränen über das Gesicht des alten Mannes liefen, besonders als er über meinen ermordeten Bruder sprach; Und als der Priester sagte, dass die Zeit der Reue für mich kommen würde, aber niemand da wäre, der mir helfen könnte, brach er vor Aufregung seine Rede ab und erklärte, sein Herz sei erfüllt und er könne kein Wort mehr sagen.
Ich war von dieser Rede aufrichtig berührt (und wen würde das nicht berühren?) und entschloss mich fest, nicht mehr an eine Ausreise in fremde Länder zu denken, sondern mich in meiner Heimat niederzulassen, wie es mein Vater wünschte. Aber leider! - Mehrere Tage vergingen, und von meiner Entscheidung blieb nichts übrig: Mit einem Wort, einige Wochen nach meinem Gespräch mit meinem Vater beschloss ich, um neuen väterlichen Ermahnungen zu entgehen, heimlich nach Hause zu fliehen. Aber ich unterdrückte die erste Glut meiner Ungeduld und handelte langsam: Ich wählte eine Zeit, in der meine Mutter, wie es mir schien, geistig besser gelaunt war als sonst. Ich führte sie in eine Ecke und sagte ihr, dass alle meine Gedanken so in sie vertieft seien der Wunsch, fremde Länder zu sehen, dass ich, selbst wenn ich mich an ein Geschäft hänge, immer noch nicht die Geduld habe, es bis zum Ende durchzuziehen, und dass es besser wäre, wenn mein Vater mich freiwillig gehen ließe, sonst würde ich es tun gezwungen sein, ohne seine Erlaubnis zu handeln. Ich sagte, ich sei achtzehn Jahre alt, und in diesen Jahren sei es zu spät, einen Beruf zu erlernen, zu spät, um sich auf die Anwaltslaufbahn vorzubereiten. Und selbst wenn ich, sagen wir, Schreiber bei einem Anwalt werden würde, weiß ich im Voraus, dass ich vor der Probezeit vor meinem Gönner davonlaufen und zur See fahren würde. Ich bat meine Mutter, meinen Vater davon zu überzeugen, mich als Erlebnis reisen zu lassen; dann, wenn mir dieses Leben nicht gefällt. Ich kehre nach Hause zurück und werde nicht wieder gehen; und gab sein Wort, die verlorene Zeit mit doppeltem Eifer aufzuholen.
Meine Worte verärgerten meine Mutter sehr. Sie sagte, es sei sinnlos, mit meinem Vater über dieses Thema zu sprechen, da er meine Vorteile zu gut verstehe und meiner Bitte nicht nachkommen würde. Sie fragte sich, wie ich nach meinem Gespräch mit meinem Vater, der mich so sanft und freundlich überzeugte, noch über solche Dinge nachdenken konnte. Wenn ich mich selbst zerstören will, ist dieses Unglück natürlich nicht zu ändern, aber ich kann sicher sein, dass weder sie noch mein Vater jemals ihre Zustimmung zu meiner Idee geben werden; Sie selbst will nicht im Geringsten zu meinem Tod beitragen, und ich werde nie das Recht haben zu sagen, dass meine Mutter mich verwöhnt hat, als mein Vater dagegen war.
Später erfuhr ich, dass meine Mutter sich zwar weigerte, für mich bei meinem Vater Fürsprache einzulegen, sie ihm aber dennoch Wort für Wort unser Gespräch übermittelte. Der Vater war sehr besorgt über diese Wende und seufzte zu ihr: „Der Junge könnte glücklich sein, wenn er in seiner Heimat bliebe, aber wenn er in fremde Länder geht, wird er das erbärmlichste und unglücklichste Geschöpf sein, das es je gab.“ jemals auf der Erde geboren wurde. Nein, dem kann ich nicht zustimmen.“
Erst fast ein Jahr nach dem, was beschrieben wurde, konnte ich mich befreien. Während dieser ganzen Zeit blieb ich hartnäckig taub gegenüber jedem Vorschlag, in ein Unternehmen einzusteigen, und machte meinem Vater und meiner Mutter oft Vorwürfe wegen ihrer entschiedenen Vorurteile gegenüber dem Leben, zu dem mich meine natürlichen Neigungen hinzogen. Aber eines Tages, während meines Aufenthalts in Hull, wo ich zufällig Halt machte, diesmal ohne an Flucht zu denken, begann einer meiner Freunde, der mit dem Schiff seines Vaters nach London fuhr, mich zu überreden, mit ihm abzureisen, indem er das Schiff benutzte Der übliche Köder der Seeleute, nämlich dass meine Überfahrt mich nichts kosten würde. Und so, ohne den Vater oder die Mutter zu fragen, ohne sie auch nur mit einem einzigen Wort zu benachrichtigen, sondern es ihnen zu überlassen, es herauszufinden, wie sie es mussten – ohne um den Segen der Eltern oder des Göttlichen zu bitten, ohne die Umstände zu berücksichtigen im Moment, keine Konsequenzen, auf eine unfreundliche Art – Gott weiß! – Uhr, 1. September 1651, ich bestieg das Schiff meines Freundes und fuhr nach London. Ich glaube, noch nie haben die Missgeschicke junger Abenteurer so früh begonnen und so lange gedauert wie bei mir. Kaum hatte unser Schiff die Mündung des Humbert verlassen, wehte der Wind und es begann eine schreckliche Aufregung. Bis dahin war ich noch nie auf See gewesen und kann nicht in Worte fassen, wie schlecht es mir ging und wie erschüttert meine Seele war. Erst jetzt dachte ich ernsthaft darüber nach, was ich getan hatte und wie gerechtfertigt die himmlische Strafe für mich war, weil ich das Haus meines Vaters so skrupellos verlassen und meine kindliche Pflicht verletzt hatte. Alle guten Ratschläge meiner Eltern, die Tränen meines Vaters, die Gebete meiner Mutter wurden in meiner Erinnerung wiederbelebt, und mein Gewissen, das sich damals noch nicht ganz in mir verhärtet hatte, machte mir schwere Vorwürfe, dass ich die Ermahnungen meiner Eltern vernachlässigt und meine eigenen verletzt habe Pflichten gegenüber Gott und meinem Vater,
Mittlerweile wurde der Wind stärker und hohe Wellen zogen über das Meer, obwohl dieser Sturm keine Ähnlichkeit mit dem hatte, was ich viele Male später sah, oder sogar mit dem, was ich ein paar Tage später sehen musste. Aber das reichte aus, um einen solchen Neuling in maritimen Angelegenheiten zu verblüffen, der wie ich damals noch nichts davon wusste. Bei jeder neuen Welle, die über uns rollte, erwartete ich, dass sie uns verschlucken würde, und jedes Mal, wenn das Schiff, wie es mir schien, in den Abgrund oder Abgrund des Meeres fiel, war ich mir sicher, dass es nicht wieder auferstehen würde. Und in dieser seelischen Qual beschloss ich fest und schwor wiederholt, dass ich, wenn es dem Herrn gefiele, mein Leben dieses Mal zu verschonen, wenn mein Fuß wieder festen Boden unter den Füßen bekäme, ich sofort nach Hause zu meinem Vater zurückkehren würde und niemals, solange Ich war am Leben, würde mich wieder hinsetzen. zum Schiff; Ich schwor, auf den Rat meines Vaters zu hören und mich nie wieder solchen Strapazen auszusetzen, wie ich sie damals erlebte. Jetzt erst verstand ich die volle Wahrheit der Argumentation meines Vaters über die goldene Mitte; Mir wurde klar, wie friedlich und angenehm er sein Leben führte, ohne Stürmen auf See ausgesetzt zu sein oder unter Problemen an der Küste zu leiden, und ich beschloss, voller Reue in mein Elternhaus zurückzukehren, wie ein wahrer verlorener Sohn.
Diese nüchternen und besonnenen Gedanken genügten mir für die ganze Dauer des Sturms und sogar noch einige Zeit länger; Aber am nächsten Morgen begann der Wind nachzulassen, die Aufregung ließ nach und ich begann mich allmählich an das Meer zu gewöhnen. Wie dem auch sei, ich war den ganzen Tag über sehr ernst (allerdings hatte ich mich noch nicht vollständig von der Seekrankheit erholt); aber gegen Ende des Tages klarte das Wetter auf, der Wind hörte auf und ein ruhiger, bezaubernder Abend brach an; Die Sonne ging wolkenlos unter und ging am nächsten Tag ebenso klar auf, und die Weite des Meeres bot bei völliger oder fast völliger Ruhe, ganz in den Glanz der Sonne getaucht, ein entzückendes Bild, das ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Ich habe in dieser Nacht gut geschlafen und von meiner Seekrankheit war keine Spur mehr zu sehen. Ich war sehr fröhlich und schaute überrascht auf das Meer, das gestern noch tobte und grollte und sich in so kurzer Zeit beruhigen und ein so attraktives Aussehen annehmen konnte. Und dann, als wollte er meine guten Absichten ruinieren, kam mein Freund, der mich dazu überredet hatte, mit ihm zu gehen, auf mich zu und sagte, indem er mir auf die Schulter klopfte: „Na, Bob, wie fühlst du dich nach gestern? Das Du hattest Angst, gib es zu: Du hattest gestern Angst, als der Wind wehte?“ - „Eine Brise? Eine gute Brise! Ich könnte mir einen so schrecklichen Sturm gar nicht vorstellen!“ - „Stürme! Oh, du Exzentriker! Deiner Meinung nach ist das also ein Sturm? Wovon redest du! Unsinn! Gebt uns ein gutes Schiff und mehr Platz, damit wir so einen Sturm nicht einmal bemerken. Nun ja, Du bist noch ein unerfahrener Segler, Bob. Lass es uns besser machen: „Machen wir uns etwas Punsch und vergessen wir alles. Schau, was für ein wunderbarer Tag heute ist!“ Um diesen traurigen Teil meiner Geschichte abzukürzen, erzähle ich ganz offen, was als nächstes passierte, wie es bei Seeleuten üblich ist: Sie machten Punsch, ich betrank mich und ertrank im Schlamm dieser Nacht, all meine Reue, all die lobenswerten Überlegungen zu meinem früheren Verhalten und alle meine guten Entscheidungen für die Zukunft. Mit einem Wort, sobald sich die Meeresoberfläche glättete, sobald die Stille nach dem Sturm wiederhergestellt war und mit dem Sturm auch meine aufgeregten Gefühle nachließen und die Angst, von den Wellen verschluckt zu werden, verging, flossen meine Gedanken entlang des alten Kanals, und alle meine Gelübde, alle Versprechen, die ich mir in Momenten der Not gemacht hatte, waren vergessen. Gewiss, manchmal überkam mich die Erleuchtung, ernsthafte Gedanken versuchten sozusagen immer noch zurückzukehren, aber ich vertrieb sie, bekämpfte sie wie mit Krankheitsanfällen, und mit Hilfe von Trunkenheit und fröhlicher Gesellschaft triumphierte ich bald über diese Anfälle. wie ich sie nannte; In nur fünf oder sechs Tagen habe ich mein Gewissen so vollständig besiegt, wie es sich ein junger Mann wünschen kann, der beschlossen hat, nicht darauf zu achten. Aber ich hatte noch eine weitere Prüfung vor mir: Die Vorsehung wollte mir, wie immer in solchen Fällen, meine letzte Entschuldigung nehmen; Wenn ich dieses Mal tatsächlich nicht verstand, dass er mich gerettet hatte, dann war die nächste Prüfung so, dass der allerletzte, eingefleischte Schurke unserer Mannschaft nicht umhin konnte, sowohl die Gefahr als auch die wundersame Befreiung daraus zu erkennen ihr.
Am sechsten Tag nach der Seefahrt erreichten wir die Reede von Yarmouth. Der Wind war nach dem Sturm immer bösartig und schwach, also bewegten wir uns ruhig. Bei Yarmouth mussten wir vor Anker gehen und lagen dort sieben oder acht Tage lang bei entgegengesetztem, nämlich südwestlichem Wind. In dieser Zeit kamen viele Schiffe aus Newcastle auf die Reede. (Yarmouth Roadstead dient als gemeinsamer Ankerplatz für Schiffe, die hier auf guten Wind warten, um in die Themse einzulaufen.)
Wir hätten jedoch nicht so lange gestanden und wären mit der Flut in den Fluss gelangt, wenn der Wind nicht so frisch gewesen wäre, und fünf Tage später hätte er nicht noch stärker geblasen. Allerdings gilt die Reede von Yarmouth als ebenso guter Ankerplatz wie der Hafen, und unsere Anker und Ankerseile waren stark; Daher machten sich unsere Leute überhaupt keine Sorgen, rechneten nicht mit Gefahren und teilten ihre Freizeit nach dem Brauch der Seeleute zwischen Ruhe und Unterhaltung auf. Doch am achten Tag, am Morgen, frischte der Wind noch mehr auf und alle fleißigen Hände waren gefragt, um die Topmasten abzunehmen und alles Notwendige fest zu befestigen, damit das Schiff sicher auf der Reede bleiben konnte. Gegen Mittag herrschte große Aufregung; das Schiff begann heftig zu schaukeln; er schaufelte mehrmals mit der Seite, und ein- oder zweimal schien es uns, als wären wir von unserem Anker gerissen worden. Dann befahl der Kapitän, die Anlegestelle aufzugeben. So blieben wir mit bis zum Ende gespannten Seilen auf zwei Ankern gegen den Wind.
Unterdessen brach ein schwerer Sturm aus. Verwirrung und Entsetzen waren jetzt sogar in den Gesichtern der Matrosen sichtbar. Mehrmals hörte ich den Kapitän selbst, der aus seiner Kabine an mir vorbeiging und mit leiser Stimme murmelte: „Herr, erbarme dich unserer, sonst werden wir alle zugrunde gehen, das Ende ist für uns alle gekommen“, was ihn nicht daran hinderte, jedoch von einer aufmerksamen Beobachtung des Rettungsschiffes. Die ersten Minuten der Aufregung machten mich taub: Ich lag regungslos in meiner Kabine unter der Treppe und weiß nicht einmal genau, was ich fühlte. Es fiel mir schwer, zu meiner früheren Reuestimmung zurückzukehren, nachdem ich sie so deutlich vernachlässigt und so entschlossen damit umgegangen war: Es schien mir, dass die Schrecken des Todes ein für alle Mal vorbei seien und dass dieser Sturm im Nichts enden würde. wie der erste.“ Nicht als der Kapitän selbst, der vorbeikam, wie ich gerade sagte, erklärte, dass wir alle sterben würden, hatte ich schreckliche Angst. Ich verließ die Kabine auf dem Deck: Noch nie in meinem Leben hatte ich so etwas Unheilvolles gesehen Bild: Wellen, so hoch wie Berge, zogen über das Meer, und alle drei, vier Minuten kenterte ein solcher Berg über uns. Als ich meinen Mut zusammennahm und mich umsah, herrschte überall Schrecken und Unheil. Zwei schwer beladene Schiffe, unweit von uns vor Anker lagen, schnitten alle Masten ab, um sich leichter zu machen. Einer unserer Matrosen schrie: „Ein Schiff, das eine halbe Meile vor uns lag, sank. Zwei weitere Schiffe wurden aus ihren Ankern gerissen und aufs offene Meer getragen.“ Die Gnade des Schicksals, denn keiner von ihnen hatte einen einzigen Mast mehr. Kleine Schiffe hielten sich besser als andere und litten nicht so sehr auf See; aber zwei oder drei von ihnen wurden auch aufs Meer getragen, und sie stürmten mit der Breitseite an uns vorbei, nachdem sie alle Segel bis auf einen Heckklüver entfernt hatten.
Am Abend wandten sich der Navigator und der Bootsmann an den Kapitän mit der Bitte, den Fockmast fällen zu dürfen. Der Kapitän wollte das wirklich nicht, aber der Bootsmann begann ihm zu beweisen, dass das Schiff sinken würde, wenn der Fockmast verlassen würde, und er stimmte zu, und als der Fockmast abgerissen wurde, begann der Großmast so stark zu schwingen und zu schaukeln Schiff so sehr, dass es abgerissen werden musste und somit das Deck geräumt werden musste.
Sie können beurteilen, was ich die ganze Zeit über gefühlt haben muss – ein völliger Neuling in maritimen Angelegenheiten, nicht lange bevor mir eine kleine Aufregung solche Angst einjagte. Aber wenn meine Erinnerung mich nach so vielen Jahren nicht täuscht, war es damals nicht der Tod, der mir Angst machte: Was mich hundertmal mehr erschreckte, war der Gedanke, dass ich meine Entscheidung, meinem Vater zu beichten, verraten hatte und zu meinen ursprünglichen verdammten Chimären zurückgekehrt war , und diese Gedanken gepaart mit Angststürmen brachten mich in einen Zustand, den man mit Worten nicht beschreiben kann. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Der Sturm tobte weiterhin mit solcher Wucht, dass sie nach eigenen Angaben der Seeleute noch nie etwas Vergleichbares gesehen hatten. Unser Schiff war stark, aber aufgrund der großen Ladung lag es tief im Wasser und schwankte so sehr, dass man an Deck ständig hören konnte: „Das wird überwältigend, es hat Schlagseite.“ In gewisser Weise war es für mich ein großer Vorteil, dass ich die Bedeutung dieser Worte erst ganz verstand, als ich danach fragte. Der Sturm tobte jedoch immer heftiger, und ich sah – und das sieht man nicht oft –, wie der Kapitän, der Bootsmann und mehrere andere Leute, deren Sinne wahrscheinlich nicht so abgestumpft waren wie die der anderen, jede Minute darauf warteten und beteten das Schiff würde auf den Grund segeln. Um das Grauen noch zu krönen, schrie plötzlich mitten in der Nacht einer der Leute, der in den Laderaum hinuntergegangen war, um zu sehen, ob dort alles in Ordnung sei, dass das Schiff ein Leck gehabt habe, ein anderer Bote berichtete, dass das Wasser bereits ausgelaufen sei vier Fuß gestiegen. Dann kam der Befehl; „Alle an die Pumpe!“ Als ich diese Worte hörte, sank mein Herz und ich fiel rücklings auf die Pritsche, auf der ich saß. Aber die Matrosen wiesen mich weg und sagten, wenn ich bisher nutzlos gewesen wäre, könnte ich jetzt wie jeder andere arbeiten. Dann stand ich auf, ging zur Pumpe und begann fleißig zu pumpen. Zu dieser Zeit lichteten mehrere kleine Frachtschiffe, die dem Wind nicht standhalten konnten, den Anker und stachen in See. Als der Kapitän sie im Vorbeigehen bemerkte, befahl er, die Kanone abzufeuern, um auf unsere Not aufmerksam zu machen. Da ich die Bedeutung dieses Schusses nicht verstand, stellte ich mir vor, dass unser Schiff abgestürzt sei oder dass etwas Schreckliches passiert sei; mit einem Wort, ich hatte solche Angst, dass ich ohnmächtig wurde. Aber da es an der Zeit war, dass sich jeder nur um die Rettung seines eigenen Lebens kümmerte, schenkten sie mir keine Beachtung und waren nicht daran interessiert herauszufinden, was mit mir passiert war. An meiner Stelle stand ein anderer Matrose an der Pumpe, stieß mich mit dem Fuß weg und ließ mich liegen, in der festen Überzeugung, dass ich tot umgefallen war; Es verging eine ganze Weile, bis ich aufwachte.
Wir arbeiteten weiter, aber das Wasser stieg im Laderaum immer höher. Es war offensichtlich, dass das Schiff sinken würde, und obwohl der Sturm allmählich nachließ, bestand keine Hoffnung, dass es über Wasser bleiben würde, während wir in den Hafen einliefen, und der Kapitän feuerte weiterhin mit seinen Kanonen ab und rief um Hilfe. Schließlich riskierte ein kleines Schiff vor uns, ein Boot herabzulassen, um uns zu helfen. Mit großer Gefahr näherte sich das Boot uns, aber weder wir konnten uns ihm nähern, noch konnte das Boot an unserem Schiff festmachen, obwohl die Menschen mit aller Kraft ruderten und ihr Leben riskierten, um unseres zu retten. Unsere Matrosen warfen ihnen ein Seil mit einer Boje zu und dehnten es auf eine große Länge. Nach vielen vergeblichen Anstrengungen gelang es ihnen, das Ende des Seils zu fangen; Wir zogen sie unter das Heck und jeder einzelne von ihnen ging ins Boot. Es hatte keinen Sinn, auch nur daran zu denken, damit zu ihrem Schiff zu gelangen; Daher wurde im allgemeinen Einvernehmen beschlossen, mit dem Wind zu rudern und nur zu versuchen, so nah wie möglich am Ufer zu bleiben. Unser Kapitän versprach den ausländischen Seeleuten, dass er ihren Besitzer dafür bezahlen würde, wenn ihr Boot am Ufer zerschellte. So fuhren wir teils mit Rudern, teils vom Wind angetrieben nach Norden in Richtung Winterton Ness und wandten uns allmählich dem Land zu.
Es war kaum eine Viertelstunde vergangen, seit wir das Schiff verlassen hatten, als es vor unseren Augen zu sinken begann. Und dann verstand ich zum ersten Mal, was es bedeutet, „überwältigt“ zu sein. Ich muss jedoch zugeben, dass ich fast nicht die Kraft hatte, das Schiff anzusehen, nachdem ich die Schreie der Matrosen gehört hatte, dass es unterging Von dem Moment an, als ich ausstieg oder, noch besser, als ich ins Boot gebracht wurde, schien alles in mir gestorben zu sein, teils aus Angst, teils aus Gedanken an die Missgeschicke, die noch vor mir lagen.
Während die Leute hart mit ihren Rudern arbeiteten, um das Boot zum Ufer zu steuern, konnten wir sehen (denn jedes Mal, wenn das Boot von einer Welle hin und her geworfen wurde, konnten wir das Ufer sehen) - konnten wir sehen, dass sich dort eine große Menschenmenge versammelt hatte: Alle waren geschäftig und rannten und bereiteten sich darauf vor, uns zu helfen, wenn wir näher kamen. Aber wir bewegten uns sehr langsam und erreichten das Land erst, nachdem wir den Winterton Lighthouse passiert hatten, wo die Küste zwischen Winterton und Cromer eine Kurve nach Westen macht und ihre Vorsprünge daher die Kraft des Windes ein wenig milderten. Hier landeten wir und unter großen Schwierigkeiten, aber immer noch sicher an Land zu gelangen, gingen wir zu Fuß nach Yarmouth. In Yarmouth behandelten sie uns dank der Katastrophe, die uns widerfuhr, sehr mitfühlend: Die Stadt stellte uns gute Räumlichkeiten zur Verfügung und Privatpersonen – Kaufleute und Reeder – versorgten uns mit genügend Geld, um nach London oder nach Hull zu gelangen, wie wir wollten.
Oh, warum kam mir damals nicht der Gedanke, nach Gull zum Haus meiner Eltern zurückzukehren! Wie glücklich wäre ich! Wahrscheinlich hätte mein Vater, wie im Gleichnis des Evangeliums, ein gemästetes Kalb für mich geschlachtet, denn von meiner Erlösung erfuhr er erst lange, nachdem ihn die Nachricht erreicht hatte, dass das Schiff, auf dem ich Hull verließ, auf der Reede von Yarmouth untergegangen war.
Aber mein böses Schicksal trieb mich mit einer Hartnäckigkeit, der ich nicht widerstehen konnte, auf diesem katastrophalen Weg weiter; und obwohl in meiner Seele immer wieder eine nüchterne Stimme der Vernunft zu hören war, die mich zur Rückkehr nach Hause aufrief, fehlte mir dafür die Kraft. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, und deshalb werde ich nicht darauf bestehen, dass wir durch den geheimen Befehl dazu ermutigt werden, die Werkzeuge unserer eigenen Zerstörung zu sein, selbst wenn wir sie vor uns sehen und mit offenen Augen darauf zugehen vom allmächtigen Schicksal; aber es besteht kein Zweifel daran, dass nur mein unglückseliges Schicksal, dem ich nicht entgehen konnte, mich dazu zwang, den nüchternen Argumenten und Vorschlägen des größten Teils meines Wesens zu widersprechen und zwei so klare Lektionen zu vernachlässigen, die ich während meines ersten Studiums erhalten hatte Versuchen Sie, einen neuen Weg einzuschlagen.
Der Sohn unseres Reeders, mein Freund, der mir geholfen hat, mich in meiner desaströsen Entscheidung zu stärken, hat sich jetzt mehr beruhigt als ich: beim ersten Mal, als er in Yarmouth mit mir sprach (was erst zwei oder drei Tage später geschah, da wir zugeteilt wurden). In verschiedenen Räumen bemerkte ich, dass sich sein Ton verändert hatte. In einer sehr düsteren Stimmung fragte er mich kopfschüttelnd, wie es mir ginge. Nachdem er seinem Vater erklärt hatte, wer ich sei, sagte er, dass ich diese Reise als … unternommen hätte Erfahrung, und in Zukunft hatte ich vor, überall mit Licht zu reisen. Dann wandte sich sein Vater an mich und sagte in ernstem und besorgtem Ton: „Junger Mann! Sie sollten nie wieder zur See fahren; Sie müssen das, was uns passiert ist, als klares und zweifelsfreies Zeichen dafür auffassen, dass Sie nicht dazu bestimmt sind, Seemann zu werden.“ - „Warum, Sir? - Ich habe Einspruch erhoben. „Willst du nicht auch mehr schwimmen?“ „Das ist eine andere Sache“, antwortete er: „Schwimmen ist mein Beruf und daher meine Pflicht.“ Aber man macht sich auf den Weg zur See als Erlebnis. Der Himmel hat Ihnen also einen Vorgeschmack darauf gegeben, was Sie erwarten können, wenn Sie bei Ihrer Entscheidung beharren. Vielleicht ist alles, was uns passiert ist, Ihretwegen passiert: Vielleicht waren Sie Jona auf unserem Schiff... Bitte“, fügte er hinzu, „erklären Sie mir deutlich, wer Sie sind und was Sie zu dieser Reise bewogen hat.“ Dann erzählte ich ihm etwas darüber Ich selbst. Sobald ich fertig war, brach er in schreckliche Wut aus. „Was habe ich getan“, sagte er, „was habe ich getan, dass dieser elende Ausgestoßene das Deck meines Schiffes betritt!“ Nie wieder, nicht für tausend Pfund, werde ich zustimmen, mit Ihnen auf demselben Schiff zu segeln!“ Natürlich geschah dies alles im Herzen eines Mannes, der bereits durch den Gedanken an seinen Verlust aufgewühlt war, und in seiner Wut ging er weiter, als er hätte tun sollen. Aber dann hatte ich ein ruhiges Gespräch mit ihm, in dem er mich ernsthaft davon überzeugte, die Vorsehung nicht zu meinem Untergang herauszufordern und zu meinem Vater zurückzukehren, indem er sagte, dass ich in allem, was geschah, den Finger Gottes sehen sollte. „Ah, junger Mann! - sagte er abschließend, - wenn du nicht nach Hause zurückkehrst, dann - glaub mir - überall, wo du hingehst, werden dich Unglücke und Misserfolge verfolgen, bis die Worte deines Vaters an dir wahr werden.
Bald darauf trennten wir uns, ich konnte nichts gegen ihn einwenden und sah ihn nicht wieder. Wo er Yarmouth verlassen hat, weiß ich nicht; Ich hatte etwas Geld und fuhr auf dem Landweg nach London. Sowohl in London als auch auf dem Weg dorthin hatte ich oft Momente des Zweifels und des Nachdenkens darüber, welche Art von Leben ich wählen sollte und ob ich nach Hause zurückkehren oder eine neue Reise antreten sollte.
Was die Rückkehr in das Haus meiner Eltern angeht, übertönte die Scham die überzeugendsten Argumente in meinem Kopf: Ich stellte mir vor, wie alle unsere Nachbarn mich auslachen würden und wie beschämt ich mich schämen würde, nicht nur meinen Vater und meine Mutter anzusehen, sondern überhaupt unsere Bekannten. Seitdem ist mir vor allem in der Jugend oft aufgefallen, wie unlogisch und widersprüchlich die menschliche Natur ist; Wenn man die Überlegungen ablehnt, die man in solchen Fällen leiten sollte, schämt sich der Mensch nicht der Sünde, sondern der Reue; er schämt sich nicht der Handlungen, für die er mit Recht als verrückt bezeichnet werden kann, sondern der Korrektur, für die er allein als vernünftig angesehen werden kann.
Ich blieb ziemlich lange in diesem Zustand und wusste nicht, was ich tun und welchen Lebensbereich ich wählen sollte. Ich konnte den Widerwillen, nach Hause zurückzukehren, nicht überwinden, und während ich es hinauszögerte, wurde die Erinnerung an die Katastrophen, die ich erlitten hatte, nach und nach gelöscht, zusammen mit ihr die ohnehin schon schwache Stimme der Vernunft, die mich drängte, geschwächt und geschwächt zu meinem Vater zurückzukehren Es endete damit, dass ich jeden Gedanken an eine Rückkehr verdrängte und begann, von einer neuen Reise zu träumen.
Dieselbe böse Macht. was mich dazu veranlasste, aus dem Haus meiner Eltern zu fliehen, was mich auf die absurde und unüberlegte Idee verleitete, durch das Durchstreifen der Welt ein Vermögen zu verdienen, und mir diesen Unsinn so fest in den Kopf hämmerte, dass ich für alles taub blieb der gute Rat, die Ermahnungen und sogar das Verbot meines Vaters – dieselbe Kraft, sage ich, welcher Art auch immer, hat mich in das unglücklichste Unternehmen gedrängt, das man sich vorstellen kann: Ich bestieg ein Schiff, das zu den Küsten Afrikas fuhr oder, wie unsere Seeleute sagen es in ihrer Sprache, nach Guinea und begann erneut zu wandern.
Mein großes Unglück war, dass ich bei all diesen Abenteuern nicht als einfacher Seemann angeheuert wurde; Obwohl ich etwas mehr arbeiten musste, als ich es gewohnt war, lernte ich die Pflichten und die Arbeit eines Seemanns kennen und könnte mit der Zeit Navigator oder Steuermann werden, wenn nicht sogar Kapitän. Aber so war mein Schicksal – von allen Wegen habe ich den schlechtesten gewählt. Das habe ich in diesem Fall getan: Ich hatte Geld im Portemonnaie, ein anständiges Kleid auf den Schultern und bin immer wie ein echter Gentleman zum Schiff gekommen, habe also dort nichts gemacht und nichts gelernt .
In London hatte ich das Glück, von den ersten Schritten an in gute Gesellschaft zu geraten, was solch ausschweifenden, irregeleiteten Jugendlichen wie mir damals nicht oft passiert, denn der Teufel gähnt nicht und stellt ihnen sofort irgendeine Falle. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ich traf einen Kapitän, der kürzlich an die Küste Guineas gesegelt war, und da diese Reise für ihn sehr erfolgreich war, beschloss er, erneut dorthin zu fahren. Er verliebte sich in mein Unternehmen – damals konnte ich ein angenehmer Gesprächspartner sein – und nachdem er von mir erfahren hatte, dass ich davon träumte, die Welt zu sehen, lud er mich ein, mit ihm zu gehen, und sagte, dass es mich nichts kosten würde Ich würde sein Tischbegleiter und Freund sein. Wenn ich die Möglichkeit habe, Waren mitzunehmen, dann habe ich vielleicht Glück und erhalte den gesamten Gewinn aus dem Handel.
Ich habe das Angebot angenommen; Nachdem ich die freundschaftlichsten Beziehungen zu diesem Kapitän, einem ehrlichen und unkomplizierten Mann, aufgebaut hatte, machte ich mich mit ihm auf den Weg und nahm eine kleine Ladung mit, mit der ich dank der völligen Desinteresse meines Freundes, des Kapitäns, ein sehr lukratives Geschäft abschloss: Nach seinen Anweisungen kaufte ich für vierzig Pfund Sterling verschiedene Schmuckstücke und Schmuckstücke. Diese vierzig Pfund sammelte ich mit Hilfe meiner Verwandten, mit denen ich in Briefwechsel stand und die, wie ich annehme, meinen Vater bzw. meine Mutter überzeugten, mir bei meinem ersten Unterfangen zumindest mit einem kleinen Betrag zu helfen.
Man könnte sagen, diese Reise war die einzig erfolgreiche aller meiner Abenteuer, was ich der Selbstlosigkeit und Ehrlichkeit meines Freundes, des Kapitäns, verdanke, unter dessen Anleitung ich mir außerdem beträchtliche Kenntnisse in Mathematik und Navigation aneignete und lernte, ein Schiff zu halten Schiffstagebuch lesen, Beobachtungen machen und allgemein lernen, dass es eine Menge gibt, die ein Seemann wissen muss. Er hat es genossen, mit mir zu arbeiten, und ich hatte Freude am Lernen. Mit einem Wort, auf dieser Reise wurde ich Seemann und Kaufmann: Ich erhielt für meine Waren fünf Pfund und neun Unzen Goldstaub, wofür ich bei meiner Rückkehr nach London fast dreihundert Pfund Sterling erhielt. Dieses Glück erfüllte mich mit ehrgeizigen Träumen, die später meinen Tod vollendeten.
Aber auch auf dieser Reise hatte ich einiges zu ertragen, und vor allem war ich ständig krank, weil ich mir ein schweres Tropenfieber zugezogen hatte (eine Krankheit, die in heißen Klimazonen auftritt und für die Einheimische aus kälteren Ländern und damit auch Europäer anfällig sind). Erstens Eine der bemerkenswertesten Erscheinungsformen dieser Krankheit ist: Für einen Kranken erscheint das Meer wie eine grüne Wiese, und manchmal kommt es vor, dass eine Person, die über diese Wiese gehen will, ins Wasser springt und stirbt.) Aufgrund des Übermaßes heißes Klima, denn die Küste, an der wir am meisten Handel trieben, liegt zwischen dem fünfzehnten Grad nördlicher Breite und dem Äquator.
Also wurde ich Händler, der mit Guinea handelte. Da mein Freund, der Kapitän, zu meinem Unglück bald nach seiner Ankunft in seinem Heimatland starb, beschloss ich, auf eigene Faust noch einmal nach Guinea zu reisen. Ich segelte von England aus auf demselben Schiff, dessen Kommando nun auf den Assistenten von übergegangen war Der verstorbene Kapitän. Es war die unglücklichste Reise, die jemals ein Mensch unternommen hat. Es ist wahr, dass ich nicht einmal hundert Pfund meines erworbenen Kapitals mitgenommen habe und die restlichen zweihundert Pfund der Witwe von zur sicheren Aufbewahrung überlassen habe Mein verstorbener Freund, der es sehr gewissenhaft entsorgt hat; aber andererseits passierten mir während der Reise schreckliche Probleme. Es begann damit, dass eines Tages im Morgengrauen unser Schiff auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln, oder besser gesagt, zwischen den Kanarische Inseln und das afrikanische Festland wurden von einem türkischen Korsaren aus Saleh überrascht, der uns mit vollen Segeln verfolgte. Wir hoben auch die Segel, was unsere Rahen und Masten aushalten konnten, aber da der Pirat uns überholte und dies unweigerlich tun würde Nachdem wir das in ein paar Stunden aufgeholt hatten, bereiteten wir uns auf den Kampf vor (wir hatten zwölf Kanonen und er hatte achtzehn). Gegen drei Uhr nachmittags überholte er uns, näherte sich uns aber versehentlich von der Seite, anstatt wie beabsichtigt vom Heck her. Wir richteten acht Kanonen auf ihn und feuerten eine Salve auf ihn ab, woraufhin er sich etwas weiter zurückzog, nachdem er auf unser Feuer zunächst nicht nur mit einer Kanonensalve, sondern auch mit einer Gewehrsalve von zweihundert Kanonen reagiert hatte, da es bis zu waren zweihundert Leute dabei. Es hat jedoch niemandem geschadet: Unsere Reihen blieben geschlossen. Dann bereitete sich der Pirat auf einen neuen Angriff vor, und wir bereiteten uns auf eine neue Verteidigung vor. Diesmal näherte er sich uns von der anderen Seite und ging an Bord: Ungefähr sechzig Leute stürmten auf unser Deck, und alle eilten zuerst, um die Takelage zu durchtrennen. Wir begegneten ihnen mit Gewehrfeuer, Speeren und Handgranaten und befreiten unser Deck zweimal von ihnen. Da unser Schiff jedoch unbrauchbar gemacht wurde und drei unserer Leute getötet und acht verwundet wurden, mussten wir abschließend (ich kürze diesen traurigen Teil meiner Geschichte) kapitulieren und wurden als Gefangene nach Saleh auf See gebracht Hafen der Mauren.
Mein Schicksal erwies sich als weniger schrecklich, als ich zunächst befürchtet hatte. Ich wurde nicht wie der Rest unseres Volkes ins Landesinnere an den Hof des Sultans gebracht; Der Kapitän des Räuberschiffes hielt mich als Sklave, weil ich jung, beweglich und für ihn geeignet war. Dieser dramatische Schicksalswechsel, der mich von einem Kaufmann in einen elenden Sklaven verwandelte, erdrückte mich buchstäblich, und dann erinnerte ich mich an die prophetischen Worte meines Vaters, dass die Zeit kommen würde, in der es niemanden mehr geben würde, der mir aus der Not helfen und mich trösten würde Ich – Worte, die, dachte ich, jetzt definitiv wahr wurden, als die rechte Hand Gottes mich bestrafte und ich unwiderruflich starb. Aber leider! Es war nur ein blasser Schatten der schweren Prüfungen, die ich durchmachen musste, wie die Fortsetzung meiner Geschichte zeigen wird.
Da mich mein neuer Herr, genauer gesagt der Herr, in seinem Haus aufnahm, hoffte ich, dass er mich bei seiner nächsten Reise mitnehmen würde. Ich war mir sicher, dass ihn früher oder später ein spanisches oder portugiesisches Schiff fangen würde, und dann würde mir meine Freiheit zurückgegeben werden. Aber meine Hoffnung verschwand bald, denn nachdem er aufs Meer hinausgefahren war, überließ er es mir, mich um seinen Garten zu kümmern und im Allgemeinen die niederen Arbeiten zu erledigen, die Sklaven zugeteilt wurden; Als ich von der Kreuzfahrt zurückkam, befahl er mir, mich auf dem Schiff in der Kabine niederzulassen, um auf ihn aufzupassen.
Von diesem Tag an dachte ich an nichts anderes als Flucht und erfand Wege, um meinen Traum zu verwirklichen, aber ich fand keinen, der auch nur die geringste Hoffnung auf Erfolg geben würde. Und es war schwer, sich die Erfolgsaussichten eines solchen Unternehmens vorzustellen, denn ich hatte niemanden, dem ich vertrauen konnte, niemanden, den ich um Hilfe bitten konnte – es gab keinen einzigen Sklaven wie mich. kein einziger Engländer, kein einziger Ire oder Schotte – ich war ganz allein; So hatte ich zwei Jahre lang (obwohl ich in dieser Zeit oft in Freiheitsträumen schwelgte) nicht den Hauch einer Hoffnung auf die Umsetzung meines Plans. Doch nach zwei Jahren ereignete sich ein außergewöhnlicher Vorfall, der in meiner Seele meinen langjährigen Fluchtgedanken wieder aufleben ließ, und ich beschloss erneut, einen Fluchtversuch zu wagen. Eines Tages saß mein Kapitän länger als sonst zu Hause und rüstete sein Schiff nicht aus (aus Geldnot, wie ich hörte). Während dieser Zeit fuhr er ständig, ein- bis zweimal pro Woche und bei schönem Wetter öfter, mit einem Schiff an die Küste, um zu angeln. Auf jeder solchen Reise nahm er mich und den jungen Mauren als Ruderer mit, und wir unterhielten ihn nach besten Kräften. Und da ich mich außerdem als sehr geschickter Fischer erwies, schickte er mich und einen Jungen – Maresco, wie sie ihn nannten – manchmal zum Fischen unter der Aufsicht eines erwachsenen Mauren, seines Verwandten.
Und dann gingen wir eines ruhigen Morgens ans Meer. Als wir die Segel setzten, entstand so dichter Nebel, dass wir das Ufer aus den Augen verloren, obwohl es nicht einmal anderthalb Meilen von uns entfernt war. Wir begannen wahllos zu rudern; Nachdem wir den ganzen Tag und die ganze Nacht mit den Rudern gearbeitet hatten, sahen wir bei Anbruch des Morgens das offene Meer rundherum, denn anstatt ans Ufer zu gehen, segelten wir von dort aus mindestens sechs Meilen weit. Am Ende erreichten wir das Haus, allerdings nicht ohne Schwierigkeiten und mit einiger Gefahr, da am Morgen ein ziemlich frischer Wind wehte; Wir waren alle sehr hungrig.
Durch dieses Abenteuer belehrt, beschloss mein Gastgeber, in Zukunft vorsichtiger zu sein und verkündete, dass er nie wieder ohne Kompass und ohne Proviant angeln gehen würde. Nach der Eroberung unseres Schiffes behielt er unser Langboot für sich und befahl nun seinem Schiffszimmermann, ebenfalls ein englischer Sklave, auf diesem Langboot im mittleren Teil desselben eine kleine Kajüte oder Kajüte, wie auf einem Lastkahn, zu bauen, hinter der man Lassen Sie Platz für eine Person, die das Steuerrad steuert und das Großsegel kontrolliert, und vorne für zwei, um die restlichen Segel zu befestigen und zu entfernen, deren Ausleger sich über dem Dach der Kabine befand. Die Kabine war niedrig und sehr komfortabel, so geräumig, dass drei darin schlafen konnten und einen Tisch und Proviantschränke unterbringen konnten, in denen mein Herr Brot, Reis, Kaffee und Flaschen mit den Getränken aufbewahrte, die er auf der Reise trinken wollte.
Wir gingen oft auf diesem Langboot angeln, und da ich der geschickteste Fischer war, ging der Besitzer nie ohne mich hinaus. Eines Tages machte er sich bereit, mit zwei oder drei wichtigen Mauren aufzubrechen (zum Angeln oder einfach nur zu einer Fahrt – das kann ich nicht sagen), nachdem er mehr Proviant für diese Reise vorbereitet hatte als gewöhnlich, und am Abend schickte er sie zum Langboot. Außerdem befahl er mir, drei Kanonen mit der nötigen Menge Schießpulver und Ladungen von seinem Schiff zu holen, da sie neben dem Fischen auch jagen wollten.
Ich tat alles, was er befahl, und wartete am nächsten Morgen auf dem Langboot, sauber gewaschen und völlig bereit, Gäste zu empfangen, mit Wimpeln und gehisster Flagge. Der Besitzer kam jedoch alleine und sagte, dass seine Gäste die Reise aufgrund einer unerwarteten Wendung der Ereignisse verschoben hätten. Dann befahl er uns dreien – mir, dem Jungen und dem Mauren – wie immer zum Fischen ans Meer zu gehen, da seine Freunde mit ihm speisen würden und ich daher, sobald wir Fisch gefangen hätten, ihn mitbringen sollte es zu sich nach Hause. Ich gehorchte.
Hier blitzte in mir erneut der langjährige Gedanke an die Befreiung auf. Jetzt stand mir ein kleines Boot zur Verfügung, und sobald der Besitzer weg war, begann ich mit den Vorbereitungen – allerdings nicht zum Angeln, sondern für eine lange Reise, obwohl ich nicht nur nicht wusste, sondern auch nicht einmal darüber nachdachte, wo ich war würde meinen Weg weisen: Jeder Weg war gut für mich, nur um der Gefangenschaft zu entkommen.
Mein erster Trick bestand darin, den Mauren davon zu überzeugen, dass wir uns mit Lebensmitteln eindecken mussten, da wir kein Recht hatten, auf Leckereien vom Tisch des Herrn zu zählen. Er antwortete, dass es wahr sei, und brachte einen großen Korb mit Semmelbröseln und drei Krüge mit frischem Wasser auf das Langboot. Ich wusste, wo der Besitzer eine Kiste Wein hatte (wie die Etiketten auf den Flaschen zeigten, die er von einem englischen Schiff erbeutet hatte), und während die Mauren an Land waren, transportierte ich sie alle zum Langboot und stellte sie in den Schrank wenn sie noch früher für den Eigentümer vorbereitet wurden. Außerdem brachte ich ein großes Stück Wachs mit, das fünfzig Pfund wog, und schnappte mir einen Strang Garn, eine Axt, eine Säge und einen Hammer. All dies war später für uns sehr nützlich, insbesondere das Wachs, aus dem wir Kerzen hergestellt haben. Ich bediente mich noch eines anderen Tricks, auf den der Mohr ebenfalls aus Einfachheit seiner Seele hereinfiel. Sein Name war Ismael und alle nannten ihn Moli oder Muli. Also sagte ich zu ihm: „Moly, wir haben die Geschütze des Kapitäns auf dem Langboot. Was wäre, wenn du etwas Schießpulver und Ladungen hättest? Vielleicht könnten wir zum Abendessen zwei oder drei Alki (einen Vogel wie unseren Flussuferläufer) erschießen. Der Besitzer behält Schießpulver.“ und auf das Schiff geschossen, ich weiß.“ „Okay, ich bringe es mit“, sagte er und brachte eine große Ledertasche mit Schießpulver (mit einem Gewicht von anderthalb Pfund, wenn nicht mehr) und eine weitere mit Schrot, die fünf oder sechs Pfund wog. Er erbeutete auch Kugeln. Wir haben das alles in das Langboot gepackt. Außerdem befand sich in der Kapitänskajüte noch etwas Schießpulver, das ich in eine der großen Flaschen goss, die in der Kiste waren, nachdem ich zuvor den restlichen Wein daraus eingegossen hatte. Nachdem wir uns mit allem Notwendigen für die Reise eingedeckt hatten, verließen wir den Hafen, um angeln zu gehen. Der Wachturm an der Hafeneinfahrt wusste, wer wir waren, und unser Schiff fiel nicht auf. Nachdem wir uns nicht mehr als eine Meile vom Ufer entfernt hatten, entfernten wir das Segel und begannen, uns zum Angeln vorzubereiten. Der Wind wehte aus Nordnordost, was meinen Plänen nicht entgegenkam, denn wenn er von Süden geweht hätte, hätte ich durchaus bis zur spanischen Küste segeln können, zumindest bis nach Cádiz; Aber egal, wo der Wind jetzt wehte, ich hatte mich fest für eines entschieden: von diesem schrecklichen Ort wegzukommen und den Rest dem Schicksal zu überlassen.
Nachdem ich eine Weile gefischt hatte und nichts gefangen hatte – ich habe meine Angelruten absichtlich nicht herausgezogen, als meine Fische angebissen haben, damit der Mohr nichts sah – sagte ich zu ihm: „Hier wird es für uns nicht klappen.“ ; Der Besitzer wird uns für einen solchen Fang nicht danken. Wegziehen. Da er keinen Trick meinerseits vermutete, stimmte der Maure zu, und da er sich am Bug des Langboots befand, setzte er die Segel. Ich saß am Ruder, und als das Langboot weitere drei Meilen ins offene Meer gefahren war, legte ich mich hin, um mich treiben zu lassen, als wollte ich mit dem Angeln beginnen. Dann reichte ich dem Jungen das Lenkrad, näherte mich dem Mohr von hinten, bückte mich, als würde ich etwas untersuchen, packte ihn plötzlich am Körper und warf ihn über Bord. Er tauchte sofort wieder auf, weil er wie ein Korken schwebte, und fing an zu schreien, um mich anzuflehen, ihn auf das Langboot mitzunehmen, und versprach, dass er mit mir bis ans Ende der Welt fahren würde. Er schwamm so schnell, dass er mich sehr bald eingeholt hätte, da fast kein Wind wehte. Dann ging ich zur Hütte, nahm dort eine Waffe, zielte auf ihn und sagte, dass ich ihm nichts Böses wünsche und ihm nichts Böses tun würde, wenn er mich in Ruhe ließe. „Du schwimmst gut“, fuhr ich fort, „das Meer ist ruhig, also kostet es dich nichts, ans Ufer zu schwimmen, und ich werde dich nicht anfassen; aber versuche einfach, in der Nähe des Langboots zu schwimmen, und ich“ Ich werde dir sofort in den Schädel schießen, denn ich bin fest entschlossen, deine Freiheit zurückzugewinnen. Dann wandte er sich dem Ufer zu und schwamm sicher ohne Schwierigkeiten dorthin, da er ein ausgezeichneter Schwimmer war.
Natürlich könnte ich den Jungen ins Meer werfen und diesen Mauren mitnehmen, aber auf Letzteres konnte ich mich nicht verlassen. Als er weit genug gesegelt war, wandte ich mich an den Jungen (sein Name war Xuri) und sagte zu ihm: „Xuri! Wenn du mir treu bist, werde ich dich zu einem großartigen Mann machen, aber wenn du dir nicht das Gesicht streichelst.“ ein Zeichen dafür, dass du mich nicht betrügen wirst (das heißt, du wirst nicht beim Bart Mohammeds und seines Vaters schwören), ich werde dich auch ins Meer werfen.“ Der Junge lächelte, sah mir direkt in die Augen und antwortete so aufrichtig, dass ich nicht anders konnte, als ihm zu glauben. Er schwor, dass er mir vertrauen und mit mir bis ans Ende der Welt gehen würde.
Bis das Segelmoor außer Sichtweite war, steuerte ich direkt aufs offene Meer und kreuzte gegen den Wind. Ich tat dies mit Absicht, um zu zeigen, dass wir uns auf dem Weg zur Straße von Gibraltar befanden (wie natürlich jeder vernünftige Mensch denken würde). Konnte man sich tatsächlich vorstellen, dass wir vorhatten, nach Süden zu fahren, zu diesen wirklich barbarischen Küsten, wo ganze Horden von Schwarzen mit ihren Kanus uns umzingeln und töten würden, wohin wir, sobald wir den Boden betraten, hingerissen würden Stücke von Raubtieren oder noch rücksichtslosere Wildtiere in Menschengestalt?
Doch sobald es anfing zu dämmern, änderte ich den Kurs und begann, nach Süden zu steuern, wobei ich leicht nach Osten schwenkte, um mich nicht zu weit von der Küste zu entfernen. Dank einer ziemlich frischen Brise und der Abwesenheit von rauer See kamen wir so gut voran, dass wir am nächsten Tag um drei Uhr nachmittags, als zum ersten Mal Land vor uns auftauchte, nicht weniger als 150 Meilen zurückgelegt hatten südlich von Saleh, weit über die Grenzen der Besitztümer des marokkanischen Sultans und aller anderen örtlichen Herrscher hinaus; Zumindest haben wir keinen einzigen Menschen gesehen.
Aber ich fürchtete mich so sehr vor den Mauren und hatte solche Angst, wieder in ihre Hände zu fallen, dass ich, einen günstigen Wind ausnutzend, ganze fünf Tage lang segelte, ohne anzuhalten, ohne das Ufer zu berühren oder den Anker zu werfen. Fünf Tage später drehte sich der Wind auf Süd, und da nach meinen Überlegungen, wenn es eine Verfolgung hinter uns gäbe, unsere Verfolger sie hätten aufgeben sollen, da sie uns noch nicht eingeholt hatten, beschloss ich, mich dem Ufer zu nähern und stand vor Anker an der Mündung eines kleinen Flusses. Was für ein Fluss das war und wo er fließt, in welchem Land, zwischen welchen Menschen und auf welchem Breitengrad – ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Menschen am Ufer gesehen und wollte es auch nicht; Ich musste mich nur mit frischem Wasser eindecken. Wir betraten diese Bucht am Abend und beschlossen, als es dunkel wurde, zum Ufer zu schwimmen und die Gegend zu erkunden. Doch sobald es dunkel wurde, hörten wir so schreckliche Geräusche vom Ufer – ein so hektisches Brüllen, Bellen und Heulen unbekannter Wildtiere, dass der arme Junge vor Angst fast starb und mich anflehte, erst bei Tagesanbruch an Land zu gehen. „Okay, Xuri“, sagte ich zu ihm, „aber vielleicht sehen wir dort im Laufe des Tages Menschen, unter denen wir wahrscheinlich noch schlimmer leiden werden als unter Tigern und Löwen.“ „Und wir werden sie mit einer Waffe erschießen“, sagte er lachend, „und sie werden weglaufen.“ (Von den englischen Sklaven lernte Xuri, gebrochenes Englisch zu sprechen.) Ich war froh, dass der Junge so fröhlich war , und um zu unterstützen, dass er diese gute Laune in sich hatte, gab er ihm ein Glas Wein aus dem Vorrat des Meisters. Sein Rat war im Grunde nicht schlecht, und ich befolgte ihn. Wir gingen vor Anker und blieben die ganze Nacht verborgen. Ich sage: versteckt, weil wir keine Minute geschlafen haben. Ungefähr zwei oder drei Stunden nachdem wir vor Anker gegangen waren, sahen wir riesige Tiere am Ufer (von denen wir selbst nichts wussten): Sie näherten sich dem Ufer, stürzten ins Wasser, planschten und zappelte, offensichtlich wollte er sich erfrischen, und als sie so ekelhaft schrien, brüllten und heulten, wie ich es noch nie in meinem Leben gehört hatte.
Xuri hatte schreckliche Angst, und um ehrlich zu sein, ich auch. Aber wir hatten beide noch mehr Angst, als wir hörten, dass eines dieser Monster auf unser Langboot zuschwamm; Wir haben es nicht gesehen, aber aus der Art, wie es schnaufte und schnaufte, konnten wir schließen, dass es sich um ein wildes Tier von monströser Größe handelte. Xuri behauptete, es sei ein Löwe (vielleicht war es einer – zumindest bin ich mir nicht sicher), und rief uns zu, wir sollten den Anker lichten und von hier verschwinden. „Nein, Xuri“, antwortete ich, „wir müssen den Anker nicht lichten; wir machen einfach ein längeres Seil und fahren aufs Meer hinaus: Sie werden uns dort nicht verfolgen.“ Doch bevor ich Zeit hatte, dies zu sagen, sah ich in einer Entfernung von etwa zwei Rudern vom Langboot ein unbekanntes Tier. Ich gebe zu, ich war ein wenig verblüfft, aber ich schnappte mir sofort eine Waffe in der Kabine, und sobald ich feuerte, drehte sich das Tier um und schwamm zum Ufer.
Es ist unmöglich, das höllische Brüllen und Heulen zu beschreiben, das am Ufer und weiter im Inneren des Festlandes entstand, als mein Schuss gehört wurde. Dies gab mir Anlass zu der Annahme, dass die Tiere hier dieses Geräusch noch nie gehört hatten. Ich war schließlich davon überzeugt, dass wir nicht daran zu denken hatten, nachts an diesen Orten zu landen, aber ob es möglich wäre, tagsüber zu landen, war auch eine Frage: In die Hände eines Wilden zu fallen ist nicht besser, als in die Hände zu fallen Krallen eines Löwen oder Tigers; zumindest machte uns diese Gefahr nicht weniger Angst.
Aber so oder so, hier oder anderswo, mussten wir an Land gehen, da wir keinen halben Liter Wasser mehr hatten. Aber auch hier stellt sich die Frage: Wo und wie landen? Xuri kündigte an, dass er versuchen würde, frisches Wasser zu holen und es mir zu bringen, wenn ich ihn mit einem Krug an Land gehen ließe. Und als ich ihn fragte, warum er gehen sollte und nicht ich, und warum er nicht im Boot bleiben sollte, enthielt die Antwort des Jungen so viel tiefes Gefühl, dass er mich für immer bestach. „Wenn wilde Menschen kommen“, sagte er, „werden sie mich fressen, aber du wirst in Sicherheit bleiben.“ „Also, Xuri“, sagte ich, „lass uns zusammen gehen, und wenn wilde Menschen kommen, werden wir sie töten, und sie werden weder dich noch mich fressen.“ Ich gab dem Jungen ein paar Cracker zu essen und einen Schluck Wein aus dem Vorrat des Meisters, den ich bereits erwähnt hatte; Dann zogen wir uns näher an den Boden heran und sprangen ins Wasser und machten uns auf den Weg zum Ufer in die Furt, wobei wir nichts als Waffen und zwei Wasserkrüge mitnahmen.
Ich wollte mich nicht vom Ufer entfernen, um das Langboot nicht aus den Augen zu verlieren, aus Angst, dass Wilde in ihren Pirogen den Fluss hinunter zu uns kommen könnten; Aber Ksuri bemerkte ein Tiefland in einer Entfernung von etwa einer Meile vom Ufer und wanderte mit einem Krug dorthin. Plötzlich sah ich ihn auf mich zulaufen. Ich überlegte, ob die Wilden ihn verfolgt hatten oder ob er vor einem Raubtier Angst hatte, und eilte ihm zu Hilfe, doch als ich näher rannte, sah ich, dass etwas Großes über seiner Schulter hing. Es stellte sich heraus, dass er ein Tier wie unseren Hasen getötet hatte, aber von anderer Farbe und mit längeren Beinen. Wir waren beide froh über dieses Glück, und das Fleisch des getöteten Tieres war sehr lecker; Aber die größte Freude, mit der Xuri zu mir rannte, war, dass er gutes Süßwasser vorfand und keine wilden Menschen sah.
Dann stellte sich heraus, dass wir uns nicht so sehr darum kümmern mussten, frisches Wasser zu bekommen: In dem Fluss, in dem wir standen, nur etwas höher, war das Wasser völlig frisch, da die Flut nicht sehr weit in den Fluss reichte. Nachdem wir unsere Krüge gefüllt hatten, machten wir ein Fest aus dem getöteten Hasen und bereiteten uns darauf vor, unsere Reise fortzusetzen, ohne in dieser Gegend Spuren von Menschen zu entdecken.
Da ich diese Orte bereits einmal besucht hatte, war mir klar, dass die Kanarischen Inseln und die Kapverdischen Inseln nicht weit vom Festland entfernt waren. Aber jetzt hatte ich keine Beobachtungsinstrumente bei mir und konnte daher nicht bestimmen, auf welchem Breitengrad wir uns befanden; Andererseits wusste ich nicht genau, auf welchem Breitengrad diese Inseln lagen, oder erinnerte mich zumindest nicht daran; Daher wusste ich nicht, wo ich nach ihnen suchen sollte und wann genau ich ins offene Meer abbiegen sollte, um auf sie zuzugehen; Wenn ich das wüsste, wäre es für mich nicht schwer, zu einem von ihnen zu gelangen. Aber ich hoffte, dass ich, wenn ich an der Küste entlang bliebe, bis ich den Teil des Landes erreichte, wo die Engländer Landhandel betrieben, aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein englisches Handelsschiff auf seiner üblichen Reise stoßen würde, das uns abholen würde.
Nach all meinen Berechnungen befanden wir uns nun gegenüber dem Küstenstreifen, der sich zwischen den Besitztümern des marokkanischen Sultans und den Ländern der Schwarzen erstreckt. Dies ist ein verlassenes, unbewohntes Gebiet, in dem nur wilde Tiere leben: Die Schwarzen verließen es aus Angst vor den Mauren und zogen weiter nach Süden, und die Mauren fanden es aufgrund der Unfruchtbarkeit des Bodens unrentabel, sich hier niederzulassen; oder besser gesagt, beide wurden von Tigern, Löwen, Leoparden und anderen Raubtieren, die es hier in unzähligen Mengen gibt, verscheucht. Somit dient dieses Gebiet den Mauren lediglich als Jagdrevier, wohin sie ganze Armeen schicken, jeweils zwei- bis dreitausend Menschen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir tagsüber fast hundert Meilen lang nur ein verlassenes, verlassenes Gebiet sahen und nachts nichts als das Heulen und Brüllen wilder Türen hörten.
Zweimal im Laufe des Tages schien es mir, als würde ich in der Ferne den Gipfel von Teneriffa sehen – den höchsten Gipfel des Teneriffa-Gebirges auf den Kanarischen Inseln. Ich habe sogar versucht, ins Meer abzubiegen, in der Hoffnung, dorthin zu gelangen, aber beide Male zwangen mich der Gegenwind und die starken Wellen, die für mein zerbrechliches Boot gefährlich waren, zur Umkehr, und so beschloss ich am Ende, nicht mehr von meinem Ziel abzuweichen ursprünglicher Plan und Aufenthalt entlang der Küste.
Nachdem wir die Flussmündung verlassen hatten, musste ich noch mehrmals am Ufer anlegen, um unsere Frischwasservorräte aufzufüllen. Eines frühen Morgens ankerten wir im Schutz einer ziemlich hohen Landzunge und warteten darauf, dass die bereits einsetzende Flut näher an die Küste rückte. Plötzlich rief mir Ksuri, dessen Augen offenbar schärfer waren als meine, leise zu und antwortete auf meine Frage, dass es für uns besser sei, uns vom Ufer zu entfernen:
„Sehen Sie, was für ein schreckliches Tier dort auf dem Hügel liegt und tief und fest schläft.“ Ich schaute, wohin er zeigte, und sah tatsächlich ein Monster. Es war ein riesiger Löwe, der am Uferhang im Schatten eines überhängenden Hügels lag. „Hör zu, Xuri“, sagte ich, „geh an Land und töte dieses Biest.“ Der Junge sah mich ängstlich an und sagte: „Ich muss ihn töten! Ja, er wird mich auf einmal verschlingen“ (schluckt mich ganz – er wollte sagen). Ich hatte keine Einwände gegen ihn, ich befahl ihm nur, sich nicht zu bewegen.) Ich nahm die größte Waffe, deren Kaliber fast einer Muskete entsprach, und lud sie mit zwei Bleistücken und einer ordentlichen Menge Schießpulver; Ich rollte zwei große Kugeln in die andere und fünf kleinere Kugeln in die dritte (wir hatten drei Kanonen). Ich nahm die erste Waffe, zielte gut auf den Kopf des Biests und feuerte; aber er lag in einer solchen Position (und bedeckte seine Schnauze mit der Pfote), dass die Ladung ihn am Bein traf und den Knochen oberhalb des Knies brach. Das Biest sprang knurrend auf, spürte aber Schmerzen im gebrochenen Bein, fiel sofort hin; dann erhob er sich wieder auf drei Beinen und stieß ein so schreckliches Brüllen aus, das ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Ich war ein wenig überrascht, dass ich es tat Ich traf ihn nicht am Kopf, doch ohne eine Minute zu zögern, nahm ich die zweite Waffe und feuerte hinter dem Tier her, als es vom Ufer weghumpelte; dieses Mal traf der Angriff das Ziel. Mit Vergnügen sah ich, wie der Löwe fiel und begann, kaum leise Geräusche von sich zu geben, sich in einem Kampf mit dem Tod zu winden. Dann nahm Xuri all seinen Mut zusammen und begann zu bitten, an Land zu gehen. „Okay, geh“, sagte ich. Der Junge sprang ins Wasser und schwamm zum Ufer Er arbeitete mit einer Hand und hielt in der anderen eine Waffe. Er näherte sich dem am Boden liegenden Tier, hielt die Mündung der Waffe an sein Ohr und schoss erneut, um ihm auf diese Weise den Garaus zu machen.
Das Spiel war edel, aber ungenießbar, und es tat mir sehr leid, dass wir drei Ladungen verschwendet hatten. Aber Xuri verkündete, dass er von dem getöteten Löwen etwas profitieren würde, und als wir zum Langboot zurückkehrten, bat er mich um eine Axt. „Warum brauchst du eine Axt?“ Ich fragte. „Schneiden Sie ihm den Kopf ab“, antwortete er. Allerdings konnte er nicht den Kopf abschlagen, sondern nur die Pfote, die er mitgebracht hatte. Es war ungeheuer groß.
Dann kam mir der Gedanke, dass wir vielleicht die Haut des Löwen gebrauchen könnten, und ich beschloss, zu versuchen, sie abzunehmen. Xuri und ich gingen zur Arbeit, aber ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Es stellte sich heraus, dass Xuri viel geschickter war als ich. Diese Arbeit hat uns den ganzen Tag gekostet. Schließlich wurde die Haut entfernt; wir haben es auf dem Dach unserer Hütte ausgebreitet; Nach zwei Tagen trocknete es die Sonne und anschließend diente es mir als Bett.
Nach diesem Stopp machten wir uns noch weitere zehn bis zwölf Tage auf den Weg nach Süden, wobei wir versuchten, unseren schnell zur Neige gehenden Proviantvorrat so sparsam wie möglich auszugeben und nur für Frischwasser an Land zu gehen. Ich wollte zur Mündung des Gambia- oder Senegal-Flusses gelangen oder sogar zu einer Art Ankerplatz unweit der Kapverden, weil ich hoffte, hier ein europäisches Schiff zu treffen: Ich wusste, wenn ich es nicht treffen würde, würde ich es treffen Ich muss mich nur auf die Suche nach den Inseln machen oder hier unter den Schwarzen sterben. Ich wusste, dass alle europäischen Schiffe, egal wohin sie gehen – an die Küste Guineas, nach Brasilien oder nach Ostindien – an den Kapverden oder den gleichnamigen Inseln vorbeifahren: Mit einem Wort, ich habe mein ganzes Schicksal auf diese Karte gesetzt, Mir wurde klar, dass ich entweder einem europäischen Schiff begegnen oder sterben würde.
Also erfüllte ich weitere zehn Tage lang meine Absicht. Dann bemerkte ich, dass die Küste bewohnt war: An zwei oder drei Stellen sahen wir Menschen am Ufer, die uns wiederum ansahen. Wir konnten auch erkennen, dass sie pechschwarz und nackt waren. Einmal wollte ich zu ihnen an Land gehen, aber Xuri, mein weiser Berater, sagte:
„Geh nicht, geh nicht.“ Dennoch begann ich, näher am Ufer zu bleiben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie müssen meine Absicht verstanden haben und liefen lange Zeit am Ufer entlang unserem Langboot hinterher. Mir fiel auf, dass sie unbewaffnet waren, bis auf einen, der einen langen, dünnen Stock in der Hand hielt. Xuri erzählte mir, dass dies eine Halskette sei und dass die Wilden Speere sehr weit und mit bemerkenswerter Genauigkeit werfen; Deshalb hielt ich etwas Abstand zu ihnen und kommunizierte so gut ich konnte mit ihnen durch Zeichen, wobei ich vor allem versuchte, ihnen klarzumachen, dass wir Nahrung brauchten. Sie begannen ihrerseits mit Zeichen, dass ich mein Boot anhalten solle und dass sie uns Essen bringen würden. Sobald ich das Segel eingeholt hatte und lossegelte, rannten zwei schwarze Männer irgendwo ins Landesinnere und brachten in einer halben Stunde oder weniger zwei Stücke Trockenfleisch und etwas Getreidekörner aus der Region. Wir wussten nicht, um welche Fleischsorte es sich handelte oder um welche Getreidesorte es sich handelte, äußerten aber unsere volle Bereitschaft, beides zu akzeptieren. Doch dann stellte sich eine neue Frage: Wie bekommt man das alles hin? Aus Angst vor den Wilden wagten wir es nicht, an Land zu gehen, und diese wiederum hatten nicht weniger Angst vor uns. Schließlich fanden sie einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit. für beide Seiten gleichermaßen sicher: Nachdem sie Getreide und Fleisch am Ufer aufgetürmt hatten, entfernten sie sich und blieben regungslos stehen, bis wir alles zum Langboot transportierten; und dann an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht.
Wir dankten ihnen mit Zeichen, weil wir nichts anderes hatten, womit wir ihnen danken konnten. Aber genau in diesem Moment hatten wir die Gelegenheit, ihnen einen großen Dienst zu erweisen. Bevor wir uns vom Ufer entfernen konnten, rannten plötzlich zwei riesige Tiere aus den Bergen und stürzten direkt auf das Meer zu. Einer von ihnen, wie es uns schien, jagte den Anderen: Ob es ein Männchen war, das ein Weibchen jagte, ob sie miteinander spielten oder sich stritten – wir konnten nicht erkennen, ebenso wenig wie wir sagen konnten, ob das so war ein an diesen Orten häufiges Phänomen oder ein Ausnahmefall; Ich denke jedoch, dass Letzteres richtiger war, denn erstens tauchen in Kalya tagsüber selten Raubtiere auf und zweitens fiel uns auf, dass die Menschen, die sich am Ufer aufhielten, vor allem die Frauen, schreckliche Angst hatten. Nur der Mann, der den Speer oder Speer hielt, blieb an Ort und Stelle; der Rest fing an zu rennen. Aber die Tiere flogen direkt ins Meer und versuchten nicht, die Schwarzen anzugreifen. Sie stürzten ins Wasser und begannen zu schwimmen, als ob Schwimmen der einzige Zweck ihres Erscheinens wäre. Plötzlich schwamm einer von ihnen ganz nah am Langboot vorbei. Das habe ich nicht erwartet; Nachdem ich jedoch schnell die Waffe geladen und Xuri befohlen hatte, die beiden anderen zu laden, bereitete ich mich darauf vor, dem Feind zu begegnen, sobald er sich uns in Schussweite näherte. Ich drückte den Abzug und die Kugel traf ihn direkt in den Kopf Im selben Moment tauchte er ins Wasser, tauchte dann auf und schwamm zurück zum Ufer, verschwand dann unter Wasser und tauchte dann wieder an der Oberfläche auf. Offenbar kämpfte er mit dem Tod, erstickte am Wasser und blutete aus einer tödlichen Wunde. und bevor er ein wenig ans Ufer schwamm, starb er.
Es ist unmöglich zu beschreiben, wie erstaunt die armen Wilden waren, als sie das Knallen hörten und das Feuer eines Gewehrschusses sahen: Einige von ihnen starben vor Angst fast und fielen wie tot zu Boden. Doch als sie sahen, dass das Tier gesunken war und ich ihnen Zeichen gab, näher zu kommen, fassten sie Mut und gingen ins Wasser, um das tote Tier herauszuziehen. Ich fand ihn an den blutigen Stellen im Wasser, warf ein Seil über ihn und warf das Ende davon den Schwarzen zu, die ihn ans Ufer zogen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine seltene Leopardenrasse mit einer gefleckten Haut von außergewöhnlicher Schönheit handelte. Die Schwarzen, die über ihm standen, hoben verwundert die Hände: Sie konnten nicht verstehen, wie ich ihn getötet habe.
Ein anderes Tier sprang aus Angst vor dem Feuer und dem Knall meines Schusses an Land und rannte zurück in die Berge; Aufgrund der Entfernung konnte ich nicht erkennen, um was für ein Tier es sich handelte. In der Zwischenzeit bemerkte ich, dass die Schwarzen unbedingt das Fleisch des getöteten Leoparden essen wollten und beschloss, es so anzurichten, als hätten sie es von mir geschenkt bekommen. Ich habe ihnen mit Zeichen gezeigt, dass sie es schaffen können. Sie dankten mir sehr und machten sich ohne Zeitverlust an die Arbeit. Obwohl sie keine Messer hatten, häuteten sie das tote Tier mit geschärften Holzstücken so schnell und geschickt, wie wir es mit einem Messer nicht geschafft hätten. Sie boten mir Fleisch an; aber ich lehnte das Fleisch ab und machte ihnen ein Zeichen, dass ich es ihnen geben würde, und verlangte nur die Haut, die sie mir sehr bereitwillig gaben. Außerdem brachten sie mir einen neuen Vorrat an Proviant, viel mehr als zuvor. und ich nahm es, obwohl ich nicht wusste, um welche Vorräte es sich handelte. Dann bat ich sie mit Schildern um Wasser: Ich hielt einen unserer Krüge hin und drehte ihn um, um zu zeigen, dass er leer war und gefüllt werden musste. Sie riefen sofort etwas Eigenes. Wenig später erschienen zwei Frauen mit einem großen Wassergefäß aus gebranntem Ton (muss in der Sonne gestanden haben) und ließen es zusammen mit Proviant am Ufer zurück. Ich schickte Xuri mit all unseren Krügen und er füllte alle drei mit Wasser. Die Frauen waren völlig nackt, ebenso die Männer.
Nachdem ich mich so mit Wasser, Wurzeln und Getreide eingedeckt hatte, trennte ich mich von den gastfreundlichen Schwarzen und setzte meine Reise weitere elf Tage in derselben Richtung fort, ohne mich dem Ufer zu nähern. Schließlich sah ich etwa fünfzehn Meilen vor mir einen schmalen Landstreifen, der weit ins Meer hineinragte. Das Wetter war ruhig und ich bog ins offene Meer ein, um diese Landzunge zu umrunden. In diesem Moment, als wir auf Höhe seiner Spitze kamen, erkannte ich deutlich einen weiteren Landstreifen sechs Meilen von der Küste entfernt auf der Meerseite und kam zu dem Schluss, dass es sich bei der schmalen Landzunge um die Kapverden handelte und dass es sich bei dem Landstreifen um die Inseln der Kapverden handelte gleicher Name. Aber sie waren sehr weit weg, und da ich nicht wagte, auf sie zuzugehen, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Mir war klar, dass ich, wenn ich von einem frischen Wind erfasst würde, wahrscheinlich weder die Insel noch das Kap erreichen würde.
Da ich über die Lösung dieses Problems nachdachte, setzte ich mich eine Minute lang in die Kabine und überließ es Xuri, das Ruder zu steuern, als ich ihn plötzlich rufen hörte: „Meister! Meister! Segel! Schiff!“ Der naive junge Mann fürchtete sich zu Tode, als er sich etwas vorstellte. dass es sicherlich eines der Schiffe seines Herrn sein musste, die uns verfolgen sollten; aber ich wusste, wie weit wir uns von den Mauren entfernt hatten, und ich war sicher, dass wir von dieser Seite nicht bedroht werden konnten. Ich sprang aus der Kabine und sah sofort nicht nur das Schiff, sondern erkannte sogar, dass es sich um ein portugiesisches Schiff handelte, das meiner Meinung nach auf dem Weg zu den Küsten Guineas war, um die Schwarzen zu holen. Aber als ich genauer hinsah, war ich überzeugt, dass das Schiff in eine andere Richtung fuhr und nicht daran dachte, sich dem Land zuzuwenden. Dann setzte ich alle Segel und wandte mich dem offenen Meer zu, wobei ich beschloss, alles zu tun, um mit ihm in den Verkehr zu kommen.
Ich war jedoch bald davon überzeugt, dass wir selbst bei voller Fahrt keine Zeit haben würden, uns ihm zu nähern, und dass er vorbeifliegen würde, bevor es möglich wäre, ihm ein Signal zu geben; Aber in diesem Moment, als ich bereits zu verzweifeln begann, mussten sie uns vom Schiff aus durch ein Teleskop gesehen und angenommen haben, dass es sich um das Boot eines verlorenen europäischen Schiffes handelte. Das Schiff senkte seine Segel, um uns die Annäherung zu ermöglichen. Das hat mich ermutigt. Auf unserem Langboot hatten wir eine Heckflagge vom Schiff unseres früheren Besitzers, und ich begann diese Flagge zu schwenken als Zeichen dafür, dass wir in Seenot waren, und feuerte außerdem eine Waffe ab. Sie sahen die Flagge und den Rauch des Schusses (den Schuss selbst hörten sie nicht); Das Schiff begann zu treiben und wartete auf unsere Annäherung, und drei Stunden später machten wir daran fest.
Sie fragten mich auf Portugiesisch, Spanisch und Französisch, wer ich sei, aber ich konnte keine dieser Sprachen. Schließlich sprach ein Seemann, ein Schotte, auf Englisch mit mir, und ich erklärte ihm, dass ich ein Engländer sei und vor den Mauren aus Saleh geflohen sei, wo ich in Gefangenschaft gehalten werde. Dann wurden mein Begleiter und ich auf das Schiff eingeladen und mit all unseren Waren sehr freundlich empfangen.
Man kann sich leicht vorstellen, mit welcher unaussprechlichen Freude mich das Bewusstsein der Freiheit nach der katastrophalen und fast aussichtslosen Situation, in der ich mich befand, erfüllte. Ich bot dem Kapitän sofort mein gesamtes Eigentum als Belohnung für meine Befreiung an, aber er lehnte großzügig ab und sagte, dass er mir nichts wegnehmen würde und dass alle meine Sachen unversehrt an mich zurückgegeben würden, sobald wir in Brasilien ankamen. „Ich habe dein Leben gerettet“, fügte er hinzu, „weil ich selbst mich an deiner Stelle gefreut hätte. Und das kann immer passieren. Außerdem werden wir dich nach Brasilien bringen, und es ist sehr weit von deiner Heimat entfernt, und.“ „Du wirst dort verhungern, wenn ich dir dein Eigentum wegnehme. Warum musste ich dich dann retten? Nein, nein, Señor Inglese (d. h. Engländer), ich werde dich kostenlos nach Brasilien bringen und deine Sachen werde ich dir geben.“ die Möglichkeit, dort zu wohnen und die Heimreise zu bezahlen.
Der Kapitän erwies sich nicht nur in Worten als großzügig, sondern erfüllte auch genau sein Versprechen. Er ordnete an, dass keiner der Seeleute es wagen sollte, mein Eigentum zu berühren, dann erstellte er eine detaillierte Bestandsaufnahme meines gesamten Eigentums, nahm alles unter seine Aufsicht und übergab mir das Inventar, damit ich es später, bei meiner Ankunft in Brasilien, konnte Erhalte jeden Gegenstand davon, bis zu drei Tonkellen.
Was mein Langboot betrifft, so sagte der Kapitän, als er sah, dass es sehr gut sei, dass er es mir gerne für sein Schiff abkaufen würde, und fragte, wie viel ich dafür bekommen wollte. Darauf antwortete ich, dass er mich in allen Belangen so großzügig behandelt habe, dass ich auf keinen Fall einen Preis für mein Boot festlegen würde, sondern es ganz ihm überlassen würde. Dann sagte er, dass er mir eine schriftliche Verpflichtung geben würde, in Brasilien achtzig Piaster dafür zu zahlen, aber wenn mir bei meiner Ankunft dort jemand mehr anbieten würde, würde er mir mehr geben. Außerdem bot er mir sechzig Goldstücke für Xuri an. Ich wollte dieses Geld wirklich nicht annehmen, und zwar nicht, weil ich Angst hatte, den Jungen dem Kapitän zu übergeben, sondern weil es mir leid tat, die Freiheit des armen Kerls verkauft zu haben, der mir selbst so hingebungsvoll geholfen hatte, sie zu bekommen. Ich habe dem Kapitän alle diese Überlegungen dargelegt, und er hat ihre Berechtigung anerkannt, mir aber geraten, den Deal nicht abzulehnen, und gesagt, dass er dem Jungen die Verpflichtung geben würde, ihn in zehn Jahren freizulassen, wenn er das Christentum annehmen würde. Das hat die Dinge verändert. Und da Xuri darüber hinaus selbst den Wunsch geäußert hatte, zum Kapitän zu gehen, habe ich darauf verzichtet.
Unsere Überfahrt nach Brasilien verlief recht sicher, und nach einer zweiundzwanzigtägigen Reise erreichten wir die Bucht von Todos los Santos, oder Allerheiligen. Ich war also wieder einmal aus der schlimmsten Situation befreit worden, in die sich ein Mensch befinden kann, und nun musste ich entscheiden, was ich mit mir anfangen sollte.
Ich werde die großzügige Haltung des Kapitäns des portugiesischen Schiffes mir gegenüber nie vergessen. Er nahm mir für die Überfahrt nichts ab, gab mir sorgfältig alle meine Sachen zurück und gab mir vierzig Dukaten für ein Löwenfell und zwanzig für ein Leopardenfell und kaufte im Allgemeinen alles, was ich verkaufen wollte, darunter eine Kiste Wein, zwei Gewehre und der Rest Wachs (von dem wir einen Teil für Kerzen verwendet haben). Mit einem Wort, ich habe zweihundertzwanzig Goldmünzen gewonnen und bin mit dieser Hauptstadt an der Küste Brasiliens gelandet.
Bald führte mich der Kapitän in das Haus eines seiner Bekannten, eines freundlichen und ehrlichen Mannes wie er. Dieser war Besitzer einer ingenio, also einer Zuckerplantage und Zuckerfabrik. Ich lebte lange Zeit mit ihm zusammen und lernte dadurch den Zuckerrohranbau und die Zuckerproduktion kennen. Als ich sah, wie gut es den Pflanzern ging und wie schnell sie reich wurden, beschloss ich, die Erlaubnis zu beantragen, mich dauerhaft hier niederzulassen und selbst dieses Geschäft aufzunehmen. Gleichzeitig versuchte ich, eine Möglichkeit zu finden, das Geld, das ich dort aufbewahrte, aus London herauszuholen. Als es mir gelang, die brasilianische Staatsbürgerschaft zu erhalten, kaufte ich mit all meinem Geld ein Stück unbebautes Land und begann, einen Plan für meine zukünftige Plantage und mein zukünftiges Anwesen zu entwerfen, entsprechend der Höhe des Geldbetrags, den ich erwartete London.
Ich hatte einen Nachbarn, einen Portugiesen aus Lissabon, englischer Herkunft, dessen Nachname Wells war. Er befand sich in ungefähr den gleichen Bedingungen wie ich. Ich nenne ihn Nachbarn, weil seine Plantage an meine grenzte. Mit ihm pflegten wir die freundschaftlichsten Beziehungen. Für mich, wie für ihn. Das Betriebskapital war sehr gering; und in den ersten zwei Jahren konnten wir uns beide kaum von unseren Plantagen ernähren. Aber als das Land kultiviert wurde, wurden wir reicher, so dass im dritten Jahr ein Teil des Landes mit Tabak bepflanzt wurde und wir für das nächste Jahr eine große Fläche für Zuckerrohr aufteilten. Aber wir brauchten beide arbeitende Hände, und dann wurde mir klar, wie unklug ich gehandelt hatte, als ich mich von dem Jungen Xuri getrennt hatte.
Aber leider! Ich habe mich nie durch Besonnenheit ausgezeichnet, und es ist nicht verwunderlich, dass ich auch dieses Mal so schlecht kalkuliert habe. Jetzt blieb mir nichts anderes übrig, als im gleichen Sinne weiterzumachen. Ich habe mir ein Geschäft auferlegt, das nichts mit meinen natürlichen Neigungen zu tun hatte, das genaue Gegenteil des Lebens, von dem ich geträumt habe, für das ich das Haus meiner Eltern verlassen und den Rat meines Vaters ignoriert habe. Darüber hinaus habe ich selbst den goldenen Mittelweg erreicht, die höchste Stufe bescheidenen Daseins, zu der mir mein Vater geraten hat und die ich mit dem gleichen Erfolg hätte erreichen können, wenn ich in meiner Heimat geblieben wäre und mich nicht mit Wanderungen um die Welt ermüdet hätte. Wie oft habe ich mir jetzt gesagt, dass ich das Gleiche in England tun könnte, wo ich unter Freunden leben würde, ohne fünftausend Meilen von meiner Heimat entfernt zu sein, unter Fremden und Wilden, in einem wilden Land, in dem selbst Nachrichten aus jenen Tagen mich nie erreichen würden? Teile der Welt, wo sie mich ein wenig kennen!
So schwelgte ich in bitteren Gedanken über mein Schicksal in Brasilien. Außer meinem Nachbarn, dem Pflanzer, mit dem ich mich gelegentlich traf, hatte ich niemanden, mit dem ich ein Wort wechseln konnte; Ich musste die ganze Arbeit mit meinen eigenen Händen erledigen und wiederholte ständig, dass ich wie auf einer einsamen Insel lebe und mich darüber beklagte, dass keine einzige Menschenseele in der Nähe sei. Wie gerechtfertigt hat mich das Schicksal bestraft, als es mich später wirklich auf eine einsame Insel warf, und wie nützlich wäre es für jeden von uns, wenn wir unsere gegenwärtige Situation mit einer anderen, noch schlimmeren vergleichen würden, daran zu denken, dass die Vorsehung jeden Moment eine Katastrophe bewirken kann Tauschen Sie sich aus und zeigen Sie uns, wie glücklich wir vorher waren! Ja, ich wiederhole, das Schicksal hat mich so bestraft, wie ich es verdient habe, als es mich zu jenem wahrhaft einsamen Leben auf einer freudlosen Insel verurteilte, mit dem ich mein damaliges Leben so unfair verglichen habe, dass ich, wenn ich die Geduld gehabt hätte, die Arbeit fortzusetzen begonnen hätte, hätte mich wahrscheinlich zu Reichtum und Glück geführt ...
Meine Pläne für die Zuckerplantage hatten bereits eine gewisse Gewissheit angenommen, als mein Gönner, der Kapitän, der mich auf dem Meer abgeholt hatte, in seine Heimat zurücksegeln sollte (sein Schiff blieb etwa drei Monate in Brasilien, während er neues abholte). Fracht für die Rückfahrt). Und als ich ihm erzählte, dass ich in London noch eine kleine Hauptstadt habe, gab er mir den folgenden freundlichen und aufrichtigen Rat:
„Señor Ingleee“, sagte er (er nannte mich immer so), „erteilen Sie mir eine formelle Vollmacht und schreiben Sie der Person in London, die Ihr Geld hat. Schreiben Sie ihr, um dort Waren für Sie zu kaufen (wie die, die es gibt). in diesen Teilen verkauft) und schicke sie nach Lissabon an die Adresse, die ich dir nennen werde; und wenn Gott will, werde ich sie zurückgeben und unversehrt an dich übergeben. Aber da menschliche Angelegenheiten allen möglichen Wechselfällen und Schwierigkeiten unterworfen sind, wenn An deiner Stelle würde ich als erstes einmal nur einhundert Pfund Sterling nehmen, also die Hälfte deines Kapitals. Zuerst riskierst du nur das. Kommt dieses Geld mit Gewinn zu dir zurück, kannst du den Rest deines Kapitals in Umlauf bringen auf die gleiche Weise, und wenn es verschwindet, dann hat man wenigstens noch etwas auf Lager.“
Der Rat war so gut und so freundlich, dass es mir so vorkam, als könne ich mir nichts Besseres einfallen lassen und ich konnte ihm nur folgen. Deshalb zögerte ich nicht, dem Kapitän eine Vollmacht zu erteilen, wie er es wünschte, und bereitete einen Brief an die Witwe des englischen Kapitäns vor, der ich einst Geld gegeben hatte, um die Eule zu retten.
Ich beschrieb ihr alle meine Abenteuer ausführlich: Ich erzählte ihr, wie ich in Gefangenschaft geriet, wie ich entkam, wie ich auf See einem portugiesischen Schiff begegnete und wie menschlich der Kapitän mich behandelte. Abschließend habe ich ihr meine aktuelle Situation geschildert und ihr die notwendigen Hinweise zum Wareneinkauf für mich gegeben. Mein Freund, der Kapitän, schickte unmittelbar nach seiner Ankunft in Lissabon über englische Kaufleute eine Warenbestellung an einen dortigen Händler in London. Ich füge eine detaillierte Beschreibung meiner Abenteuer hinzu. Der Londoner Kaufmann übergab beide Briefe sofort der Witwe des englischen Kapitäns, und sie gab ihm nicht nur den erforderlichen Betrag, sondern sandte dem portugiesischen Kapitän auch eine ziemlich stattliche Summe in Form eines Geschenks für seine humane und sympathische Person Einstellung mir gegenüber.
Nachdem ich mit all meinen hundert Pfund englische Waren gekauft hatte, schickte der Londoner Kaufmann sie ihm gemäß den Anweisungen meines Freundes, des Kapitäns, nach Lissabon, und er lieferte sie mir sicher in Brasilien aus. Unter anderem brachte er mir aus eigener Initiative (denn ich war so neu in meinem Geschäft, dass es mir gar nicht in den Sinn kam) allerlei landwirtschaftliches Gerät sowie allerlei Haushaltsgeräte. All dies waren Dinge, die für die Arbeit auf der Plantage notwendig waren, und sie alle waren für mich sehr nützlich.
Als meine Ladung ankam, war ich überglücklich und dachte, meine Zukunft sei gesichert. Mein gütiger Vormund, der Kapitän, brachte mir unter anderem einen Arbeiter, den er mit der Verpflichtung anstellte, mir sechs Jahre lang zu dienen. Zu diesem Zweck gab er seine eigenen fünf Pfund Sterling aus, die er von meiner Freundin, der Witwe eines englischen Kapitäns, geschenkt bekommen hatte. Er lehnte jede Entschädigung rundweg ab, und ich überredete ihn lediglich, einen kleinen Ballen Tabak als Frucht meiner eigenen Landwirtschaft anzunehmen.
Und das war noch nicht alles. Da die gesamte Ladung meiner Waren aus englischen Manufakturwaren bestand – Leinen, Tüchern, Tüchern und überhaupt solchen Dingen, die in diesem Land besonders geschätzt und benötigt wurden, konnte ich sie mit großem Gewinn verkaufen; Mit einem Wort, als alles ausverkauft war, vervierfachte sich mein Kapital. Dadurch war ich meinem armen Nachbarn bei der Entwicklung der Plantage weit voraus, denn mein erstes Geschäft nach dem Verkauf der Waren bestand darin, einen Negersklaven zu kaufen und neben dem, den mir der Kapitän aus Lissabon mitgebracht hatte, einen weiteren europäischen Arbeiter einzustellen.
Aber der schlechte Umgang mit materiellen Gütern ist oft der sicherste Weg zum größten Unglück. So war es bei mir. Im folgenden Jahr setzte ich die Bewirtschaftung meiner Plantage mit großem Erfolg fort und sammelte fünfzig Ballen Tabak, mehr als die Menge, die ich meinen Nachbarn im Austausch für die Lebensnotwendigen gegeben hatte. Alle diese fünfzig Ballen, von denen jeder über hundert Pfund wog, lagen getrocknet bei mir, völlig bereit für die Ankunft der Schiffe aus Lissabon. So wuchs mein Geschäft; Aber als ich reicher wurde, war mein Kopf voller Pläne und Projekte, die mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln völlig unrealistisch waren: Kurz gesagt, es waren Projekte dieser Art, die oft die besten Geschäftsleute ruinieren.
Wäre ich auf dem Gebiet geblieben, das ich selbst gewählt hatte, hätte ich wahrscheinlich auf jene Lebensfreuden gewartet, von denen mein Vater mir so überzeugend erzählte, als ständige Begleiter eines ruhigen, einsamen Daseins und einer durchschnittlichen sozialen Stellung. Aber mir stand ein anderes Schicksal bevor: Ich war immer noch dazu bestimmt, die Ursache all meines Unglücks zu sein. Und gerade um meine Lethargie zu verschlimmern und die Reflexionen über mein Schicksal, für die ich in meiner traurigen Zukunft zu viel Muße hatte, noch bitterer zu machen, waren all meine Misserfolge einzig auf meine Wanderleidenschaft zurückzuführen, der ich rücksichtslos frönte Während sich vor mir eine strahlende Aussicht auf ein nützliches und glückliches Leben eröffnete, musste ich nur fortfahren, was ich begonnen hatte, die weltlichen Segnungen nutzen, die mir die Vorsehung so großzügig geschenkt hatte, und meine Pflicht erfüllen.
Wie mir schon einmal passiert war, als ich aus dem Haus meiner Eltern weggelaufen bin, konnte ich nun mit dem Geschenk nicht zufrieden sein. Ich gab die Hoffnung auf, durch die Arbeit auf meiner Plantage zu Wohlstand, vielleicht Reichtum, zu gelangen – alles nur, weil ich von dem Wunsch überwältigt war, schneller reich zu werden, als es die Umstände erlaubten. So stürzte ich mich in den tiefsten Abgrund der Katastrophen, in den wahrscheinlich noch kein anderer Mensch gefallen ist und aus dem es kaum möglich ist, lebend und gesund herauszukommen.
Ich wende mich nun den Details dieses Teils meiner Abenteuer zu. Nachdem ich fast vier Jahre in Brasilien gelebt und mein Vermögen deutlich gesteigert habe, ist es selbstverständlich, dass ich nicht nur die Landessprache gelernt habe, sondern auch tolle Bekanntschaften mit meinen Plantagennachbarn sowie mit Kaufleuten aus San Salvador, dem nächstgelegenen Hafen, gemacht habe Stadt für uns. Bei Treffen mit ihnen erzählte ich ihnen oft von meinen beiden Reisen an die Küste Guineas, wie dort Handel mit den Schwarzen lief und wie leicht man dort für eine Kleinigkeit war – für ein paar Perlen, Messer, Scheren, Äxte, Glas usw andere ähnliche Kleinigkeiten - nicht nur Goldstaub und Elfenbein, sondern sogar eine große Anzahl Negersklaven für die Arbeit in Brasilien zu kaufen.
Sie hörten sich meine Geschichten sehr aufmerksam an, besonders wenn es darum ging, Schwarze zu kaufen. Es ist anzumerken, dass der Sklavenhandel zu dieser Zeit sehr begrenzt war und das sogenannte assiento, also die Erlaubnis des spanischen oder portugiesischen Königs, erforderte; Daher waren schwarze Sklaven selten und äußerst teuer.
Eines Tages versammelte sich eine große Gruppe von uns: ich und einige meiner Bekannten, Pflanzer und Händler, und wir führten ein lebhaftes Gespräch über dieses Thema. Am nächsten Morgen kamen drei meiner Gesprächspartner zu mir und teilten mir mit, dass sie nach sorgfältiger Überlegung, was ich ihnen am Vortag gesagt hatte, mit einem geheimen Vorschlag zu mir gekommen seien. Dann ließen sie mich versprechen, dass alles, was ich von ihnen hörte, unter uns bleiben würden, und sagten mir, dass sie alle Plantagen hätten, so wie ich, und dass sie nichts weiter brauchten als arbeitende Hände. Deshalb wollen sie ein Schiff für die Schwarzen nach Guinea schicken. Da der Sklavenhandel jedoch kompliziert ist und es ihnen unmöglich sein wird, die Schwarzen nach ihrer Rückkehr nach Brasilien offen zu verkaufen, denken sie darüber nach, sich auf eine Flucht zu beschränken, die Schwarzen heimlich mitzubringen und sie dann für ihre Plantagen unter sich aufzuteilen. Die Frage war, ob ich bereit wäre, als Schiffsschreiber auf ihr Schiff zu gehen, also den Ankauf von Schwarzen in Guinea auf mich zu nehmen. Sie boten mir die gleiche Anzahl Schwarzer an wie andere, und ich musste keinen Cent in dieses Unternehmen investieren.
Es lässt sich nicht leugnen, wie verlockend dieser Vorschlag wäre, wenn er einem Mann gemacht würde, der keine eigene Plantage hatte, die einer Aufsicht bedarf, in die beträchtliches Kapital investiert wurde und die im Laufe der Zeit ein hohes Einkommen versprach. Ohne mich, den Besitzer einer solchen Plantage, der das, was er begonnen hatte, nur noch drei oder vier Jahre weiterführen musste, nachdem er den Rest seines Geldes von England verlangt hatte – zusammen mit diesem kleinen zusätzlichen Kapital hätte mein Vermögen drei erreicht, Viertausend Pfund Sterling und wäre weiter gestiegen – für mich war der Gedanke an eine solche Reise die größte Torheit.
Aber es war mir bestimmt, der Schuldige meines eigenen Todes zu werden. Genau wie zuvor konnte ich meine Wanderneigung nicht überwinden und der gute Rat meines Vaters war vergebens, und so konnte ich auch jetzt dem mir gemachten Angebot nicht widerstehen. Mit einem Wort, ich antwortete den Pflanzern, dass ich gerne nach Guinea gehen würde, wenn sie in meiner Abwesenheit mein Eigentum übernehmen und es gemäß meinen Anweisungen entsorgen würden, falls ich nicht zurückkehre. Sie versprachen mir dies feierlich und besiegelten unsere Vereinbarung mit einer schriftlichen Verpflichtung; Ich für meinen Teil machte für den Fall meines Todes ein formelles Testament: Ich verweigerte meine Plantage und mein bewegliches Eigentum dem portugiesischen Kapitän, der mir das Leben rettete, allerdings mit der Maßgabe, dass er nur die Hälfte meines beweglichen Eigentums für sich beanspruchen würde. und den Rest nach England schicken.
Kurz gesagt, ich habe alle Vorkehrungen getroffen, um mein Eigentum zu schützen und die Ordnung auf meiner Plantage aufrechtzuerhalten. Wenn ich auch nur einen kleinen Teil dieser weisen Voraussicht in Bezug auf mein eigenes Wohl bewiesen hätte, wenn ich ein ebenso klares Urteil darüber gefällt hätte, was ich tun und was nicht, hätte ich ein so erfolgreich begonnenes und vielversprechendes Unternehmen wahrscheinlich nie aufgegeben. Ich hätte bei solch günstigen Erfolgsaussichten nicht versäumt, mich nicht auf die See zu begeben, bei der Gefahr und Risiko untrennbar miteinander verbunden sind, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich besondere Gründe hatte, von der bevorstehenden Reise allerlei Ärger zu erwarten .
Aber ich hatte es eilig und gehorchte eher blind den Anregungen meiner Fantasie als der Stimme der Vernunft. Also wurde das Schiff ausgerüstet, mit geeigneten Gütern beladen und alles wurde im gegenseitigen Einvernehmen der Expeditionsteilnehmer geregelt. Zu einer ungünstigen Stunde, am 1. September 1659, bestieg ich das Schiff. Dies war derselbe Tag, an dem ich vor acht Jahren vor meinem Vater und meiner Mutter nach Gull flüchtete – der Tag, an dem ich gegen meine elterliche Autorität rebellierte und so dumm über mein Schicksal entschied.
Unser Schiff hatte eine Kapazität von etwa einhundertzwanzig Tonnen: Es hatte sechs Kanonen und eine Besatzung von vierzehn Personen, den Kapitän, den Schiffsjungen und mich nicht mitgerechnet. Wir hatten keine schwere Ladung und alles bestand aus verschiedenen kleinen Dingen, die normalerweise für den Tausch mit Schwarzen verwendet werden: Scheren, Messer, Äxte, Spiegel, Glas, Muscheln, Perlen und andere ähnliche billige Gegenstände.
Wie bereits gesagt, ging ich am 1. September an Bord des Schiffes und noch am selben Tag lichteten wir den Anker. Wir fuhren zunächst entlang der Küste Brasiliens nach Norden und hofften, auf den afrikanischen Kontinent umzudrehen, wenn wir den zehnten oder zwölften Grad nördlicher Breite erreichten, wie es damals der übliche Schiffskurs war. Die ganze Zeit über blieben wir an unseren Ufern, bis hin zum Cape St. Augustine, das Wetter war gut, es war einfach zu heiß. Von Cape St. Augustine aus bogen wir ins offene Meer ab und verloren bald das Land aus den Augen. Wir fuhren ungefähr in Richtung der Insel Fernando de Noronha, also nach Nordosten. Fernando Island bleibt auf unserer rechten Seite. Nach einer zwölftägigen Reise überquerten wir den Äquator und befanden uns nach letzten Beobachtungen auf 7-22 Zoll nördlicher Breite, als uns plötzlich ein heftiger Sturm traf. Es war ein echter Hurrikan. Er begann von Südosten und ging dann hinein in die entgegengesetzte Richtung und wehte schließlich von Nordosten her mit so schrecklicher Kraft, dass wir zwölf Tage lang nur mit dem Wind rasen und, dem Willen des Schicksals ergeben, dorthin segeln konnten, wohin uns die Gewalt der Elemente trieb. Unnötig zu erwähnen, dass ich all diese zwölf Tage stündlich mit dem Tod gerechnet habe und niemand auf dem Schiff damit gerechnet hat, am Leben zu bleiben.
Aber unsere Sorgen beschränkten sich nicht nur auf die Angst vor dem Sturm: Einer unserer Matrosen starb an Tropenfieber, und zwei – ein Matrose und ein Schiffsjunge – wurden vom Deck gespült. Am zwölften Tag begann der Sturm nachzulassen und der Kapitän führte eine möglichst genaue Berechnung durch. Es stellte sich heraus, dass wir uns ungefähr elf Grad nördlicher Breite befanden, aber zweiundzwanzig Grad westlich von Kap St. Augustine getragen wurden. Wir befanden uns nun nicht mehr weit von der Küste Guayanas oder dem nördlichen Teil Brasiliens entfernt, jenseits des Amazonas. und näher am Orinoco-Fluss, der in diesen Gegenden eher als der Große Fluss bekannt ist. Der Kapitän fragte mich um Rat, wohin ich fahren sollte. Da das Schiff ein Leck hatte und für eine Langstreckenfahrt kaum geeignet war, hielt er es für das Beste, sich an die Küste Brasiliens zu wenden.
Aber ich habe mich entschieden dagegen aufgelehnt. Nachdem wir die Karten der amerikanischen Küste untersucht hatten, kamen wir schließlich zu dem Schluss, dass wir bis zu den Karibikinseln kein einziges bewohntes Land finden würden, in dem wir Hilfe finden könnten. Deshalb beschlossen wir, Kurs auf Barbados zu nehmen, das nach unseren Berechnungen in zwei Wochen erreicht werden könnte, da wir leicht von der direkten Route abweichen müssten, um nicht im Golf von Mexiko zu landen Dasselbe gilt auch für die Fahrt zur afrikanischen Küste: Unser Schiff musste repariert werden, und die Besatzung musste aufgestockt werden.
In Anbetracht dessen änderten wir den Kurs und begannen, West-Nordwesten zu steuern. Wir hofften, eine der zu England gehörenden Inseln zu erreichen und dort Hilfe zu erhalten. Aber das Schicksal urteilte anders. Als wir 12–18 Zoll nördlicher Breite erreichten, wurden wir von einem zweiten Sturm erfasst. Genauso schnell wie beim ersten Mal stürmten wir nach Westen und befanden uns weit entfernt von den Handelsrouten, so dass wir, selbst wenn wir nicht an der Wut von gestorben wären Durch die Wellen gab es für uns sowieso fast keine Hoffnung mehr, in unsere Heimat zurückzukehren, und wir wären höchstwahrscheinlich von Wilden gefressen worden.
Eines frühen Morgens, als wir in großer Not waren – der Wind ließ immer noch nicht nach – rief einer der Matrosen: „Land!“, doch bevor wir Zeit hatten, sprangen wir aus der Kabine in der Hoffnung herauszufinden, wo wir waren , das Schiff lief auf Grund. Im selben Moment ergoss sich bei einem plötzlichen Stopp Wasser mit solcher Wucht auf das Deck, dass wir uns bereits für tot hielten: Wir stürzten kopfüber in geschlossene Räume, wo wir vor den Spritzern und dem Schaum Zuflucht suchten.
Wer sich noch nicht in einer ähnlichen Situation befunden hat, kann sich nur schwer vorstellen, in welcher Verzweiflung wir uns befinden. Wir wussten nicht, wo wir waren, auf welches Land wir gespült wurden, ob es eine Insel oder ein Festland, ein bewohntes Land war oder nicht. Und da der Sturm weiter wütete, wenn auch mit geringerer Kraft, hofften wir nicht einmal, dass unser Schiff einige Minuten überleben würde, ohne in Stücke zu brechen; es sei denn, der Wind ändert sich plötzlich durch ein Wunder. Mit einem Wort, wir saßen da, sahen uns an und erwarteten jede Minute den Tod, und jeder bereitete sich darauf vor, in eine andere Welt zu ziehen, weil wir in dieser Welt nichts zu tun hatten. Unser einziger Trost war, dass das Schiff entgegen allen Erwartungen noch intakt war und der Kapitän sagte, dass der Wind allmählich nachließ.
Doch obwohl es für uns schien, als hätte der Wind etwas nachgelassen, war das Schiff immer noch so fest auf Grund, dass es keinen Sinn mehr machte, auch nur daran zu denken, es zu bewegen, und in dieser verzweifelten Situation konnten wir uns nur darum kümmern, unser Leben zu retten kosten. Wir hatten zwei Boote; Eines hing hinter dem Heck, aber während eines Sturms wurde es gegen das Ruder geschleudert und dann abgerissen und versenkt oder ins Meer getragen. Wir konnten uns nicht auf sie verlassen. Es war noch ein anderes Boot übrig, aber wie ließ man es zu Wasser? - Das war eine große Frage. In der Zwischenzeit war es unmöglich zu zögern: Das Schiff konnte jede Minute in zwei Teile teilen; einige sagten sogar, dass es bereits geplatzt sei.
In diesem kritischen Moment näherte sich der Kapitänsmaat dem Boot und warf es mit Hilfe der übrigen Besatzung über Bord. Wir alle, elf Personen, bestiegen das Boot, setzten die Segel und übergaben uns der Gnade Gottes anvertrauend dem Willen der tosenden Wellen; Obwohl der Sturm deutlich nachgelassen hatte, strömten immer noch schreckliche Wellen an die Küste, und das Meer konnte zu Recht „den vild Zee“ (das wilde Meer) genannt werden, wie die Holländer sagen.
Unsere Situation war wirklich bedauerlich: Wir sahen deutlich, dass das Boot solchen Wellen nicht standhalten konnte und wir unweigerlich ertrinken würden. Wir konnten nicht mit einem Segel fahren, wir hatten keins und es wäre für uns sowieso nutzlos gewesen. Wir ruderten mit einem Stein auf dem Herzen ans Ufer, wie Menschen, die zur Hinrichtung gehen: Wir alle wussten sehr gut, dass das Boot, sobald es sich dem Land näherte, von der Brandung in tausend Stücke zerschmettert würde. Und angetrieben vom Wind und der Strömung, nachdem wir unsere Seelen der Barmherzigkeit Gottes übergeben hatten, stützten wir uns auf die Ruder und brachten persönlich den Moment unseres Todes näher.
Was für ein Ufer vor uns lag – felsig oder sandig, steil oder abfallend – wussten wir nicht. Unsere einzige Hoffnung auf Rettung bestand in der schwachen Möglichkeit, in eine Bucht oder Bucht oder an die Mündung eines Flusses zu gelangen, wo die Wellen schwächer waren und wir unter dem Ufer auf der Luvseite Schutz suchen konnten. Aber vor uns war nichts wie eine Bucht zu sehen, und je näher wir der Küste kamen, desto schrecklicher kam uns das Land vor – schrecklicher als das Meer selbst.
Als wir uns entfernten, oder besser gesagt, wir wurden meiner Berechnung nach etwa vier Meilen von der Stelle entfernt, an der unser Schiff feststeckte, lief plötzlich ein riesiger Schacht, so groß wie ein Berg, vom Heck auf unser Boot, als ob im Begriff, uns in den Tiefen des Meeres zu begraben. Im Nu brachte er unser Boot zum Kentern. Bevor wir Zeit hatten, „Gott!“ zu rufen, befanden wir uns unter Wasser, weit weg vom Boot und voneinander entfernt.
Nichts kann die Verwirrung ausdrücken, die mich erfasste, als ich ins Wasser stürzte. Ich bin ein sehr guter Schwimmer, konnte jedoch nicht sofort die Oberfläche erreichen und wäre fast erstickt. Erst als die Welle, die mich gefangen hatte, nachdem sie mich ein ganzes Stück zum Ufer getragen hatte, brach und zurückstürzte und mich fast an Land zurückließ, halb tot von dem Wasser, das ich geschluckt hatte, kam ich ein wenig zu Atem und kam zu mir Sinne. Ich hatte eine solche Selbstbeherrschung, dass ich, da ich sah, dass ich näher am Boden war, als ich erwartet hatte, aufstand und kopfüber zu rennen begann, in der Hoffnung, den Boden zu erreichen, bevor eine weitere Welle auf mich zukam und mich erfasste, aber ich erkannte bald, dass ich es konnte nicht entkommen; Das Meer strömte bergauf und überholte mich wie ein wütender Feind, mit dem ich weder die Kraft noch die Mittel hatte, zu kämpfen. Ich konnte nur den Atem anhalten, auf den Wellenkamm steigen und so weit ich konnte zum Ufer schwimmen. Mein Hauptanliegen war es, die neue Welle möglichst so zu bewältigen, dass sie mich, nachdem sie mich noch näher ans Ufer gebracht hatte, auf ihrem Rückweg zum Meer nicht mitreißen würde.
Die entgegenkommende Welle begrub mich sieben, zehn Meter unter Wasser. Ich spürte, wie ich aufgenommen und mit unglaublicher Kraft und Geschwindigkeit lange Zeit zum Ufer getragen wurde. Ich hielt den Atem an und ließ mich treiben, um ihm zu helfen, so gut ich konnte. Ich war fast außer Atem, als ich plötzlich das Gefühl hatte, aufzustehen; Zu meiner großen Erleichterung waren meine Hände und mein Kopf bald über dem Wasser, und obwohl ich nicht länger als zwei Sekunden an der Oberfläche bleiben konnte, gelang es mir, wieder zu Atem zu kommen, und das gab mir Kraft und Mut. Ich war erneut überwältigt, aber dieses Mal blieb ich nicht so lange unter Wasser. Als die Welle brach und zurückging, ließ ich mich nicht zurückziehen und spürte bald den Boden unter meinen Füßen. Ich stand ein paar Sekunden da, um zu Atem zu kommen, und nachdem ich den Rest meiner Kräfte gesammelt hatte, rannte ich erneut kopfüber auf das Ufer zu.
Aber auch jetzt war ich der Gewalt des Meeres noch nicht entgangen: Noch zweimal trieb es mich hinaus, zweimal hob es mich mit einer Welle auf und trug mich immer weiter, da die Küste an dieser Stelle sehr abfallend war.
Die letzte Welle wäre für mich fast tödlich gewesen: Nachdem er mich hochgehoben hatte, trug er mich hinaus, oder besser gesagt, warf er mich mit solcher Wucht auf den Felsen, dass ich das Bewusstsein verlor und völlig hilflos war: ein Schlag auf die Seite und die Brust völlig Es raubte mir den Atem, und wenn mich das Meer erneut erwischte, würde ich unweigerlich ersticken. Aber ich kam gerade noch rechtzeitig zur Besinnung: Als ich sah, dass mich wieder eine Welle bedecken würde, klammerte ich mich fest an den Felsvorsprung und beschloss mit angehaltenem Atem zu warten, bis die Welle nachließ. Da die Wellen näher am Boden nicht mehr so hoch waren, hielt ich durch, bis sie ging. Dann fing ich wieder an zu rennen und befand mich so nah am Ufer, dass die nächste Welle mich zwar überrollte, mich aber nicht mehr verschlucken und zurück zum Meer tragen konnte. Nachdem ich noch ein wenig gelaufen war, fühlte ich mich zu meiner großen Freude auf dem Trockenen, kletterte auf die Küstenfelsen und sank ins Gras. Hier war ich in Sicherheit: Das Meer konnte mich nicht erreichen.
Als ich mich wohlbehalten am Boden wiederfand, blickte ich zum Himmel und dankte Gott für die Rettung meines Lebens, auf das ich noch vor wenigen Minuten fast keine Hoffnung mehr hatte. Ich denke, dass es keine Worte gibt, mit denen man die Freude der menschlichen Seele, die sozusagen aus dem Grab aufsteigt, mit ausreichender Anschaulichkeit beschreiben könnte, und es wundert mich überhaupt nicht, wenn der Verbrecher bereits eine Schlinge um sich hat Sein Hals, in dem Moment, in dem er an den Galgen gehängt werden soll, wird eine Begnadigung verkündet - ich wundere mich nicht, ich wiederhole, dass gleichzeitig immer ein Arzt anwesend ist, um ihn zu bluten, sonst kann die unerwartete Freude erschüttern dem Begnadigten zu viel und lässt sein Herz nicht mehr schlagen.
Plötzliche Freude beraubt ebenso wie Kummer den Geist.
Ich ging am Ufer entlang, hob meine Hände zum Himmel und machte tausende andere Gesten und Bewegungen, die ich nicht mehr beschreiben kann. Mein ganzes Wesen war sozusagen in Gedanken an meine Erlösung versunken. Ich dachte an meine Kameraden, die alle ertrunken waren und dass außer mir keine einzige Seele gerettet wurde; zumindest habe ich keinen von ihnen mehr gesehen; Von ihnen blieben keine Spuren übrig, außer drei Hüten, einer Mütze und zwei unpaarigen Schuhen, die das Meer weggeworfen hatte.
Als ich in die Richtung blickte, in der unser Schiff auf Grund lag, konnte ich es hinter der hohen Brandung kaum erkennen – es war so weit weg, und ich sagte mir: „Gott! Durch welches Wunder konnte ich ans Ufer gelangen?“
Beruhigt von diesen Gedanken über meine sichere Flucht vor der tödlichen Gefahr begann ich mich umzusehen, um herauszufinden, wo ich war und was ich zuerst tun sollte. Meine freudige Stimmung sank plötzlich: Mir wurde klar, dass ich zwar gerettet war, aber vor weiteren Schrecken und Nöten nicht verschont blieb. Es war kein trockener Faden mehr an mir, es gab nichts zum Wechseln; Ich hatte nichts zu essen, ich hatte nicht einmal Wasser, um mich zu stärken, und in Zukunft war ich damit konfrontiert, entweder zu verhungern oder von wilden Tieren in Stücke gerissen zu werden. Aber das Schlimmste ist, dass ich keine Waffen hatte, sodass ich weder Wild für mein Essen jagen konnte, noch mich gegen Raubtiere verteidigen konnte, die mich angreifen würden. Im Allgemeinen hatte ich nichts außer einem Messer, einer Pfeife und einer Schachtel Tabak. Das war alles mein Eigentum. Und da ich meine Gedanken verloren hatte, geriet ich in solche Verzweiflung, dass ich lange Zeit wie verrückt am Ufer entlang rannte. Als die Nacht hereinbrach, fragte ich mich mit sinkendem Herzen, was mich erwarten würde, wenn es hier Raubtiere gäbe: Schließlich gehen sie nachts immer auf Beute.
Das Einzige, woran ich damals denken konnte, war, auf einen dicken, verzweigten Baum zu klettern, der in der Nähe wuchs, ähnlich einer Fichte, aber mit Dornen, und die ganze Nacht darauf zu sitzen, und wenn der Morgen kommt, zu entscheiden, welcher Tod besser zu sterben ist, denn ich sah keine Gelegenheit, an diesem Ort zu leben. Ich ging eine Viertelmeile landeinwärts, um zu sehen, ob ich frisches Wasser finden konnte, und zu meiner großen Freude entdeckte ich einen Bach. Nachdem ich getrunken und mir etwas Tabak in den Mund gesteckt hatte, um meinen Hunger zu stillen, kehrte ich zum Baum zurück, kletterte darauf und versuchte, mich so zu positionieren, dass ich nicht herunterfiel, wenn ich einschlief. Dann schnitt ich zur Selbstverteidigung einen kurzen Ast aus, ähnlich einer Keule, setzte mich fester auf meinen Sitz und schlief vor extremer Müdigkeit tief und fest ein. Ich habe so gut geschlafen, wie, glaube ich, nur wenige an meiner Stelle geschlafen hätten, und ich bin noch nie so frisch und munter aus dem Schlaf erwacht.
Als ich aufwachte, war es völlig hell: Das Wetter hatte sich aufgeklärt, der Wind hatte nachgelassen und das Meer tobte und wogte nicht mehr. Aber ich war äußerst erstaunt, dass sich das Schiff an einer anderen Stelle befand, fast genau an dem Felsen, gegen den mich die Welle so hart getroffen hatte: Es muss über Nacht von der Flut wieder flott gemacht und hierher getrieben worden sein. Jetzt stand es nicht mehr als eine Meile von dem Ort entfernt, an dem ich die Nacht verbracht hatte, und da es fast gerade stand, beschloss ich, es zu besuchen, um mich mit Lebensmitteln und anderen notwendigen Dingen einzudecken.
Als ich meinen Unterschlupf verließ und vom Baum herabstieg, schaute ich mich noch einmal um, und das erste, was ich sah, war unser Boot, das etwa zwei Meilen rechts am Ufer lag, wo es offensichtlich vom Meer weggeworfen worden war. Ich begann in diese Richtung zu laufen und dachte darüber nach, dorthin zu gelangen, aber es stellte sich heraus, dass eine Bucht von einer halben Meile Breite tief ins Ufer einschnitt und den Weg versperrte. Dann kehrte ich um, denn es war mir wichtiger, schnell zum Schiff zu gelangen, wo ich etwas zum Lebensunterhalt zu finden hoffte.
Am Nachmittag hatte sich der Seegang völlig gelegt und die Flut war so niedrig, dass ich auf trockenem Boden bis auf eine Viertelmeile an das Schiff herankommen konnte. Hier verspürte ich erneut einen Anfall tiefer Trauer, denn mir wurde klar, dass alle am Leben gewesen wären, wenn wir auf dem Schiff geblieben wären: Nachdem wir den Sturm abgewartet hätten, wären wir sicher ans Ufer gegangen, und ich würde es tun Seien Sie nicht wie jetzt ein unglückliches Geschöpf, das der menschlichen Gesellschaft völlig entzogen ist. Bei diesem Gedanken traten mir Tränen in die Augen, aber Tränen konnten meine Trauer nicht lindern und ich beschloss, doch noch zum Schiff zu gelangen. Nachdem ich mich ausgezogen hatte (da der Tag unerträglich heiß war), ging ich ins Wasser. Doch als ich zum Schiff schwamm, tauchte eine neue Schwierigkeit auf: Wie klettere ich darauf? Er stand an einer flachen Stelle, alles ragte aus dem Wasser und es gab nichts, woran er sich festhalten konnte. Ich bin zweimal darum herumgeschwommen und beim zweiten Mal ist mir das Seil aufgefallen (ich bin überrascht, dass es mir nicht sofort ins Auge gefallen ist). Es hing so tief über dem Wasser, dass es mir, wenn auch mit großer Mühe, gelang, sein Ende zu fangen und daran entlang zum Vorschiff des Schiffes zu klettern. Das Schiff hatte ein Leck und ich fand viel Wasser im Laderaum; Ihr Kiel steckte jedoch so sehr im sandigen oder vielmehr schlammigen Ufer fest, dass das Heck angehoben wurde und der Bug fast das Wasser berührte. Dadurch blieb der gesamte hintere Teil wasserfrei und alles, was dort gefaltet war, wurde nicht nass. Das habe ich sofort entdeckt, denn natürlich wollte ich zunächst einmal herausfinden, was von den Dingen beschädigt wurde und was überlebte. Es stellte sich zunächst heraus, dass der gesamte Proviantvorrat völlig ausgetrocknet war, und da mich der Hunger quälte, ging ich in die Speisekammer, füllte meine Taschen mit Crackern und aß sie unterwegs, um keine Zeit zu verlieren. In der Offiziersmesse fand ich eine Flasche Rum und trank ein paar gute Schlucke daraus, denn ich brauchte dringend Verstärkung für die bevorstehende Arbeit.
Zunächst brauchte ich ein Boot, um die Dinge an Land zu transportieren, von denen ich dachte, dass ich sie brauchen könnte. Es war jedoch sinnlos, sich zurückzulehnen und von etwas zu träumen, das man nicht bekommen konnte. Die Notwendigkeit regt den Einfallsreichtum an, und ich machte mich schnell an die Arbeit. Das Schiff hatte Ersatzmasten, Topmasten und Rahen. Ich beschloss, daraus ein Floß zu bauen. Nachdem ich mehrere leichtere Baumstämme ausgewählt hatte, warf ich sie über Bord und band sie zunächst mit einem Seil fest, damit sie nicht weggetragen wurden. Dann stieg ich vom Schiff, zog vier Baumstämme zu mir heran, band sie an beiden Enden fest zusammen und befestigte sie oben mit zwei oder drei über Kreuz gelegten kurzen Brettern. Mein Floß trug das Gewicht meines Körpers perfekt, war aber zu leicht für eine große Ladung. Dann machte ich mich wieder an die Arbeit und sägte mit der Zimmermannssäge unseres Schiffs den Ersatzmast in drei Teile, die ich an meinem Floß befestigte. Diese Arbeit kostete mich unglaubliche Anstrengungen, aber der Wunsch, mich möglichst mit allem Notwendigen zum Leben einzudecken, unterstützte mich und ich tat, wozu ich unter anderen Umständen nicht die Kraft gehabt hätte.
Jetzt war mein Floß stark genug und konnte einiges an Gewicht aushalten. Meine erste Aufgabe bestand darin, es zu beladen und meine Ladung vor der Brandung zu schützen. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht. Zuerst habe ich alle Bretter, die auf dem Schiff gefunden wurden, auf das Floß gelegt: Auf diese Bretter habe ich drei Truhen unserer Matrosen herabgelassen, nachdem ich zuvor die Schlösser an ihnen aufgebrochen und sie geleert hatte. Nachdem ich dann im Kopf herausgefunden hatte, welche Dinge ich am meisten brauchen könnte, wählte ich diese Dinge aus und füllte alle drei Truhen damit. In eines legte ich Lebensmittelvorräte: Reis, Cracker, drei Scheiben holländischen Käse, fünf große Stücke getrocknetes Ziegenfleisch (das als unser Hauptfleischnahrungsmittel diente) und die Reste des Getreides, das wir für die Vögel auf dem Schiff transportierten und einige davon blieben übrig, da wir schon vor langer Zeit Vögel gegessen hatten. Es war mit Weizen vermischte Gerste; Zu meiner großen Enttäuschung stellte sich heraus, dass es von Ratten verdorben war. Ich fand auch mehrere Kisten Wein und fünf oder sechs Gallonen Arrack- oder Reislikör, die unserem Kapitän gehörten. Ich habe alle diese Kisten direkt auf dem Floß platziert, da sie nicht in die Truhen gepasst hätten und es keinen Grund gab, sie zu verstecken. Während ich mit der Ladung beschäftigt war, begann die Flut zu steigen, und zu meinem großen Kummer sah ich, dass mein Wams, mein Hemd und meine Weste, die ich am Ufer zurückgelassen hatte, ins Meer getragen wurden. So blieben mir von meinem Kleid nur noch Strümpfe und Hosen (Leinen und kurz, knielang), die ich nicht auszog. Das brachte mich dazu, darüber nachzudenken, mich mit Kleidung einzudecken. Auf dem Schiff gab es jede Menge Kleidung aller Art, aber ich nahm vorerst nur das mit, was ich gerade brauchte: Viele andere Dinge und vor allem Arbeitsgeräte reizten mich viel mehr. Nach langem Suchen fand ich unsere Schreinerkiste, und es war für mich ein wirklich kostbarer Fund, den ich damals nicht gegen eine ganze Schiffsladung Gold eingetauscht hätte. Diese Kiste stellte ich so wie sie war auf das Floß, ohne überhaupt hineinzuschauen, da ich ungefähr wusste, welche Werkzeuge sich darin befanden.
Jetzt muss ich mich nur noch mit Waffen und Munition eindecken. In der Offiziersmesse fand ich zwei schöne Jagdgewehre und zwei Pistolen, die ich zusammen mit einer Pulverflasche, einer kleinen Tüte Schrot und zwei alten rostigen Säbeln auf das Floß transportierte. Ich wusste, dass wir drei Fässer Schießpulver hatten, aber ich wusste nicht, wo unser Schütze sie aufbewahrte. Nach intensiver Suche habe ich jedoch alle drei gefunden. Einer schien nass zu sein, und zwei waren völlig trocken, und ich schleppte sie zusammen mit den Waffen und Säbeln auf das Floß. Nun war mein Floß ziemlich beladen, und ich begann darüber nachzudenken, wie ich ohne Segel, ohne Ruder und ohne Ruder ans Ufer gelangen könnte: Schließlich reichte der schwächste Wind aus, um mein gesamtes Gebilde umzuwerfen.
Drei Umstände haben mich ermutigt: erstens das völlige Fehlen von Wellen auf See; zweitens die Flut, die mich ans Ufer treiben sollte; Drittens eine leichte Brise, die ebenfalls Richtung Ufer weht und daher günstig ist. Nachdem ich also zwei oder drei kaputte Ruder von einem Schiffsboot gefunden hatte, nahm ich zwei weitere Sägen, eine Axt und einen Hammer (zusätzlich zu den Werkzeugen, die in der Kiste waren) und machte mich auf den Weg zur See. Etwa eine Meile lang lief mein Floß perfekt; Ich bemerkte nur, dass er von der Stelle weggetragen wurde, wohin mich das Meer am Tag zuvor geworfen hatte. Dies brachte mich zu der Annahme, dass es dort eine Küstenströmung geben musste und dass ich daher in einem Bach oder Fluss landen könnte, wo ich mit meiner Ladung bequem landen könnte.
Wie ich erwartet hatte, ist Folgendes passiert. Bald öffnete sich vor mir eine kleine Bucht, zu der ich schnell getragen wurde. Ich steuerte so gut ich konnte und versuchte, in der Mitte der Strömung zu bleiben. Aber hier, da ich mit dem Fahrwasser dieser Bucht überhaupt nicht vertraut war, hätte ich fast ein zweites Mal einen Schiffbruch erlitten, und wenn das passiert wäre, wäre ich wirklich, so scheint es, vor Kummer gestorben. Mein Floß prallte unerwartet mit der Kante auf die Sandbank und da die andere Kante keinen Stützpunkt hatte, kippte es stark; Noch ein bisschen mehr, und meine gesamte Ladung wäre in diese Richtung gerutscht und ins Wasser gefallen. Ich drückte meinen Rücken und meine Arme mit aller Kraft gegen meine Brust und versuchte, sie an Ort und Stelle zu halten, aber ich konnte das Floß trotz aller Bemühungen nicht schieben. Eine halbe Stunde lang stand ich in dieser Position und wagte nicht, mich zu bewegen, bis das steigende Wasser die leicht durchhängende Kante des Floßes anhob, und nach einiger Zeit stieg das Wasser noch höher und das Floß selbst schwebte wieder. Dann stieß ich mit meinem Ruder in die Mitte des Fahrwassers und gelangte schließlich, der Strömung, die hier sehr schnell war, nachgab, in eine Bucht, oder besser gesagt, in die Mündung eines kleinen Flusses mit hohen Ufern. Ich fing an, mich umzusehen und nach einem Ort zu suchen, an dem ich besser landen könnte: Ich wollte mich nicht zu weit vom Meer entfernen, weil ich hoffte, eines Tages ein Schiff darauf zu sehen, und beschloss daher, so nah wie möglich zu bleiben möglichst ans Ufer.
Schließlich entdeckte ich am rechten Ufer eine winzige Bucht, zu der ich mein Floß steuerte. Mit großer Mühe steuerte ich es über die Strömung und gelangte in die Bucht, wobei ich meine Ruder auf dem Grund ablegte. Aber hier riskierte ich erneut, meine gesamte Ladung abzuladen: Das Ufer war hier so steil, dass, wenn mein Floß nur mit einem Ende darüber gefahren wäre, es mit dem anderen Ende zwangsläufig zum Wasser geneigt wäre und mein Gepäck in Gefahr gewesen wäre. Ich konnte nur darauf warten, dass das Wasser noch weiter stieg. Nachdem ich nach einer geeigneten Stelle gesucht hatte, wo das Ufer mit einer flachen Plattform endete, bewegte ich das Floß dorthin und hielt es, mit einem Ruder auf dem Grund ruhend, wie an einem Anker; Ich habe berechnet, dass die Flut dieses Gebiet mit Wasser bedecken würde. Und so geschah es. Als das Wasser ausreichend gestiegen war – mein Floß stand einen halben Meter im Wasser – schob ich das Floß auf die Plattform, verstärkte es auf beiden Seiten mit Rudern, steckte sie in den Boden und begann auf das Ende der Flut zu warten . So landete mein Floß mit seiner gesamten Ladung an einem trockenen Ufer.
Mein nächstes Anliegen war es, die Umgebung zu erkunden und einen geeigneten Wohnort auszuwählen, an dem ich meine Sachen sicher vor Unfällen aufbewahren konnte. Ich wusste immer noch nicht, wo ich gelandet war: auf dem Festland oder auf einer Insel, in einem bewohnten oder unbewohnten Land; Ich wusste nicht, ob ich durch wilde Tiere in Gefahr war oder nicht. Ungefähr eine halbe Meile entfernt konnte ich einen steilen und hohen Hügel sehen, der offenbar einen Hügelkamm dominierte, der sich nach Norden erstreckte. Bewaffnet mit einem Gewehr, einer Pistole und einer Pulverflasche ging ich auf Erkundungstour. Als ich den Gipfel des Hügels erklomm (was mich erhebliche Mühe kostete), wurde mir mein bitteres Schicksal klar: Ich befand mich auf einer Insel; Das Meer erstreckte sich rundherum auf allen Seiten, dahinter war nirgendwo Land zu sehen, außer ein paar Felsen, die in der Ferne hervorragten, und zwei kleinen Inseln, kleiner als meine, die etwa zehn Meilen westlich lagen.
Ich machte weitere Entdeckungen: Meine Insel war völlig unbebaut und allen Anzeichen nach sogar unbewohnt. Möglicherweise waren Raubtiere darauf, aber bisher habe ich keine gesehen. Aber es gab viele Vögel, aber alle von unbekannter Rasse, so dass ich später, als ich zufällig Wild tötete, nie anhand seines Aussehens feststellen konnte, ob es zum Essen geeignet war oder nicht. Als ich den Hügel hinunterkam, erschoss ich einen großen Vogel, der in einem Baum am Waldrand saß. Ich glaube, dass dies der erste Schuss war, der hier seit der Erschaffung der Welt zu hören war: Bevor ich Zeit zum Schießen hatte, schwebte eine Vogelwolke über dem Hain; Jeder von ihnen schrie auf seine eigene Art, aber keiner dieser Schreie ähnelte den Schreien der mir bekannten Rassen. Was den Vogel betrifft, den ich getötet habe, war es meiner Meinung nach eine Variante unseres Habichts: Er ähnelte ihm sehr in der Farbe seiner Federn und der Form seines Schnabels, nur seine Krallen waren viel kürzer. Sein Fleisch schmeckte nach Aas und war nicht zum Essen geeignet.
Zufrieden mit diesen Entdeckungen kehrte ich zum Floß zurück und begann, Dinge an Land zu schleppen. Das hat mich den Rest des Tages gekostet. Ich wusste nicht, wie oder wo ich mich für die Nacht niederlassen sollte. Ich hatte Angst, direkt auf dem Boden zu liegen, weil ich nicht sicher war, ob mich irgendein Raubtier zu Tode beißen würde. Später stellte sich heraus, dass diese Befürchtungen unbegründet waren.
Deshalb habe ich, nachdem ich am Ufer einen Platz zum Übernachten abgesteckt hatte, ihn von allen Seiten mit Truhen und Kisten abgesperrt und innerhalb dieses Zauns so etwas wie eine Hütte aus Brettern gebaut. Was die Nahrung anging, wusste ich immer noch nicht, wie ich später an Nahrung kommen sollte: Außer Vögeln und zwei Tieren, wie unserem Hasen, der beim Klang meines Schusses aus dem Hain sprang, sah ich hier keine Lebewesen .
Aber jetzt dachte ich nur noch darüber nach, wie ich alles vom Schiff nehmen könnte, was dort noch übrig war und was mir nützlich sein könnte, vor allem die Segel und Taue. Deshalb beschloss ich, wenn nichts dazwischenkam, einen zweiten Ausflug zum Schiff zu machen. Und da ich wusste, dass es beim ersten Sturm in Stücke gerissen werden würde, beschloss ich, alle anderen Angelegenheiten aufzuschieben, bis ich alles, was ich mitnehmen konnte, an Land gebracht hatte. Ich begann (natürlich mit mir selbst) zu überlegen, ob ich das Floß mitnehmen sollte. Das schien mir unpraktisch, und nachdem ich auf das Ende der Flut gewartet hatte, machte ich mich auf den Weg, als wäre es das erste Mal. Nur dieses Mal zog ich mich in der Hütte aus und blieb nur in meinem unteren karierten Hemd, Leinenunterhosen und Schuhen an meinen nackten Füßen.
Wie beim ersten Mal kletterte ich mit einem Seil auf das Schiff; Dann baute er ein neues Floß. Aber aus Erfahrung habe ich gelernt, dass ich es nicht so schwerfällig gemacht habe wie das erste und es nicht so schwer beladen habe. Dennoch transportierte ich viele nützliche Dinge darauf: Erstens alles, was in unserem Tischlerbedarf zu finden war, nämlich; zwei oder drei Tüten Nägel (groß und klein), ein Schraubenzieher, zwei Dutzend Äxte und vor allem so etwas Nützliches wie ein Spitzer. Dann nahm ich mehrere Dinge aus dem Vorrat unseres Schützen, darunter drei Brechstangen aus Eisen, zwei Läufe mit Gewehrkugeln, sieben Musketen, ein weiteres Jagdgewehr und etwas Schießpulver, dann einen großen Beutel mit Schrot und eine Rolle Bleiblech. Letzteres erwies sich jedoch als so schwer, dass ich nicht genug Kraft hatte, um es anzuheben und auf das Floß abzusenken.
Zusätzlich zu den aufgeführten Dingen nahm ich alle Kleidungsstücke, die ich gefunden hatte, vom Schiff mit und schnappte mir außerdem ein Ersatzsegel, eine Hängematte sowie mehrere Matratzen und Kissen. Das alles habe ich auf das Floß geladen und zu meiner großen Freude unversehrt ans Ufer transportiert.
Als ich zum Schiff ging, hatte ich ein wenig Angst, dass in meiner Abwesenheit einige Raubtiere meine Nahrungsvorräte zerstören könnten. Aber als ich zum Ufer zurückkehrte, bemerkte ich keine Spuren der Gäste. Nur auf einer der Truhen saß ein Tier, das einer Wildkatze sehr ähnlich war. Als ich mich näherte, rannte er ein wenig zur Seite und blieb stehen, dann drehte er sich auf den Hinterbeinen und sah mir ganz ruhig und ohne Angst direkt in die Augen, als drückte er den Wunsch aus, mich kennenzulernen. Ich richtete meine Waffe auf ihn, aber diese Bewegung war für ihn offensichtlich unverständlich; Er hatte überhaupt keine Angst, er rührte sich nicht einmal von seinem Platz. Dann warf ich ihm ein Stück Cracker zu und zeigte damit große Verschwendung, da mein Vorrat an Proviant sehr gering war. Wie dem auch sei, ich habe ihm dieses Stück geschenkt. Er kam herauf, schnupperte daran, aß es und leckte es mit einem zufriedenen Blick, als warte er darauf, dass es weitergeht. Aber ich gab ihm nichts anderes und er ging.
Nachdem ich den zweiten Transport ans Ufer gebracht hatte, wollte ich die schweren Fässer mit Schießpulver öffnen und in Teilen tragen, begann aber zunächst mit dem Bau eines Zeltes. Ich habe es aus einem Segel und Stangen gemacht, die ich zu diesem Zweck im Hain geschnitten habe. Ich trug alles, was durch Sonne und Regen beschädigt werden konnte, ins Zelt und stapelte darum herum leere Kisten und Fässer für den Fall eines plötzlichen Angriffs von Menschen oder Tieren.
Ich versperrte den Eingang zum Zelt von außen mit einer großen Truhe, stellte sie seitlich auf und verkleidete die Innenseite mit Brettern. Dann breitete er ein Bett auf dem Boden aus, richtete zwei Pistolen an ihre Köpfe, eine Waffe neben die Matratze und legte sich hin. Es war das erste Mal seit dem Schiffbruch, dass ich die Nacht im Bett verbrachte. Vor Müdigkeit und Erschöpfung habe ich bis zum Morgen tief und fest geschlafen, und das ist kein Wunder: In der Nacht zuvor habe ich sehr wenig geschlafen und den ganzen Tag gearbeitet, indem ich zuerst Dinge vom Schiff auf das Floß geladen und sie dann ans Ufer transportiert habe.
Ich glaube, niemand hat sich jemals ein so großes Lagerhaus gebaut wie ich. Aber mir reichte nicht alles: Während das Schiff intakt war und an der gleichen Stelle stand und noch mindestens eine Sache darauf war, die ich gebrauchen konnte, hielt ich es für notwendig, meine Vorräte aufzufüllen. Deshalb ging ich jeden Tag bei Ebbe zum Schiff und brachte etwas mit. Meine dritte Reise war besonders erfolgreich. Ich baute die gesamte Ausrüstung ab und nahm die gesamte kleine Takelage mit (sowohl Kabel als auch Schnüre, die auf das Floß passten). Ich nahm auch ein großes Stück Ersatzsegeltuch mit, das wir zum Reparieren der Segel verwendeten, und ein Fass nasses Schießpulver, das ich auf dem Schiff gelassen hatte. Am Ende brachte ich jedes letzte Segel an Land; nur musste ich sie in Stücke schneiden und in Teilen transportieren; Die Segel nützten mir nichts, und ihr ganzer Wert lag für mich im Material.
Aber das hat mich noch mehr glücklich gemacht. Nach fünf oder sechs solcher Expeditionen, als ich dachte, dass es auf dem Schiff nichts anderes zu gewinnen gäbe, fand ich unerwartet im Laderaum ein großes Fass Cracker, drei Fässer Rum, eine Schachtel Zucker und ein Fass mit ausgezeichnetem Grieß. Es war eine angenehme Überraschung; Ich rechnete nicht mehr damit, auf dem Schiff Proviant zu finden, da ich sicher war, dass alle dort verbliebenen Vorräte nass geworden waren. Ich nahm die Cracker aus dem Fass, übertrug sie in Teilen auf das Floß und wickelte sie in Segeltuch. Es ist mir gelungen, das alles sicher an Land zu bringen.
Am nächsten Tag unternahm ich einen weiteren Ausflug. Nachdem ich nun absolut alles vom Schiff geholt hatte, was eine Person heben konnte, machte ich mich an die Arbeit an den Seilen. Ich schnitt jedes Seil in so große Stücke, dass es für mich nicht allzu schwierig war, damit umzugehen, und transportierte zwei Seile und Verankerungen zum Ufer. Außerdem habe ich alle Eisenteile, die ich trennen konnte, vom Schiff mitgenommen. Dann, nachdem ich alle restlichen Rahen abgeschnitten hatte, baute ich daraus ein größeres Floß, lud all diese schweren Dinge darauf und machte mich auf den Rückweg. Doch dieses Mal hat mich das Glück verraten: Mein Floß war so ungeschickt und so schwer beladen, dass es für mich sehr schwierig war, es zu kontrollieren. Als ich die Bucht betrat, in der der Rest meines Eigentums entladen wurde, konnte ich nicht mehr so geschickt navigieren wie zuvor: Das Floß kenterte und ich fiel mit meiner gesamten Ladung ins Wasser. Was mich betrifft, so war das Unglück nicht groß, da es fast direkt am Ufer geschah; aber meine Ladung, zumindest ein erheblicher Teil davon, war weg, die Hauptsache war Eisen, das mir sehr nützlich gewesen wäre und was ich besonders bedauerte. Als das Wasser jedoch nachließ, zog ich fast alle Seilstücke und mehrere Eisenstücke an Land, allerdings mit großer Mühe: Ich musste für jedes Stück tauchen, was mich sehr ermüdete. Danach wiederholten sich meine Besuche auf dem Schiff jeden Tag und jedes Mal brachte ich neue Beute mit.
Ich lebe bereits seit dreizehn Tagen auf der Insel und war in dieser Zeit elf Mal auf dem Schiff und habe absolut alles an Land geschleppt, was Menschenhände schleppen können. Wenn das ruhige Wetter länger gedauert hätte, hätte ich, davon bin ich überzeugt, das ganze Schiff Stück für Stück getragen, doch während ich mich auf die zwölfte Reise vorbereitete, bemerkte ich, dass der Wind zunahm. Trotzdem ging ich, nachdem ich auf das Ende der Flut gewartet hatte, zum Schiff. Beim ersten Mal durchsuchte ich unsere Hütte so gründlich, dass es mir schien, als sei es unmöglich, dort etwas zu finden; aber dann fiel mir ein Kleiderschrank mit zwei Schubladen auf: In einer fand ich drei Rasiermesser, eine große Schere und ein Dutzend gute Gabeln und Messer; der andere enthielt Geld, teils europäische, teils brasilianische Silber- und Goldmünzen, im Gesamtwert von 36 Pfund.
Ich lächelte, als ich dieses Geld sah. „Unnötiger Müll!“, sagte ich, „warum brauche ich dich jetzt? Du bist es nicht einmal wert, dass ich mich bücke und dich vom Boden aufhebe. Ich bin bereit, für irgendetwas diesen ganzen Haufen Gold herzugeben.“ Diese Messer. Ich kann dich nirgendwo hinbringen. Also bleib, wo du liegst, und geh auf den Meeresgrund wie ein Geschöpf, dessen Leben es nicht wert ist, gerettet zu werden!“ Nach einigem Überlegen beschloss ich jedoch, sie mitzunehmen und wickelte alles, was ich fand, in ein Stück Leinwand ein. Dann begann ich darüber nachzudenken, ein Floß zu bauen, aber während ich mich fertig machte, runzelte der Himmel die Stirn, der Wind, der vom Ufer wehte, wurde stärker und nach einer Viertelstunde wurde es völlig frisch. Bei auflandigem Wind wäre das Floß für mich nutzlos; Außerdem musste ich mich beeilen, um ans Ufer zu gelangen, bevor es große Aufregung gab, denn sonst hätte ich es gar nicht geschafft, dorthin zu gelangen. Ohne Zeit zu verlieren, ging ich ins Wasser und schwamm. Teilweise aufgrund des Gewichts der Sachen, die ich trug, teilweise aufgrund der Tatsache, dass ich gegen die entgegenkommenden Wellen kämpfen musste, hatte ich kaum genug Kraft, um über den Wasserstreifen zu schwimmen, der das Schiff von meiner Bucht trennte. Der Wind wurde von Minute zu Minute stärker und noch bevor die Flut nachließ, verwandelte er sich in einen richtigen Sturm.
Aber zu diesem Zeitpunkt war ich bereits zu Hause, sicher, mit all meinem Reichtum und lag in einem Zelt. Der Sturm tobte die ganze Nacht, und als ich morgens aus dem Zelt schaute, war vom Schiff keine Spur mehr zu sehen! Anfangs kam es mir unangenehm vor, aber ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich, ohne Zeit zu verschwenden und keine Mühe zu scheuen, von dort alles bekam, was mir nützlich sein konnte, so dass ich es auch tun würde, wenn ich mehr Zeit zur Verfügung hätte Ich habe immer noch fast nichts vom Schiff mitgenommen.
Ich dachte also nicht mehr an das Schiff und an die Dinge, die noch darauf übrig waren. Zwar könnten nach dem Sturm einige Trümmer an Land gespült worden sein. So geschah es später. Aber das alles nützte mir wenig.
Meine Gedanken waren nun völlig in die Frage vertieft, wie ich mich vor Wilden, falls es welche gab, und vor Tieren, falls es welche auf der Insel gab, schützen könnte. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das erreichen kann und welche Art von Unterkunft ich einrichten sollte: ob ich eine Höhle graben oder ein Zelt aufstellen und es gut verstärken soll. Am Ende habe ich mich für beides entschieden. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, hier von meinen Arbeiten zu erzählen und mein Zuhause zu beschreiben.
Ich war bald davon überzeugt, dass der von mir gewählte Ort am Ufer nicht für eine Besiedlung geeignet war: Es handelte sich um Tiefland, nahe am Meer, mit sumpfigem Boden und wahrscheinlich ungesund; Vor allem aber gab es kein frisches Wasser in der Nähe. Angesichts all dieser Überlegungen beschloss ich, nach einem anderen Ort zu suchen, der gesünder und besser zum Leben geeignet ist.
Gleichzeitig wollte ich eine Reihe von aus meiner Sicht notwendigen Auflagen einhalten. Erstens sollte mein Zuhause in einer gesunden Gegend und in der Nähe von Süßwasser liegen; zweitens sollte es Schutz vor der Hitze der Sonne bieten; Drittens muss es vor Angriffen durch zwei- und vierbeinige Raubtiere geschützt sein. und schließlich, viertens, sollte es einen Blick auf das Meer haben, um die Gelegenheit zur Flucht nicht zu verpassen, wenn Gott ein Schiff schickt. Ich wollte die Hoffnung auf Erlösung immer noch nicht aufgeben.
Nach ziemlich langer Suche fand ich schließlich eine kleine, flache Lichtung am Hang eines hohen Hügels, der mit einer steilen Klippe, steil wie eine Mauer, dorthin abfiel, so dass mich von oben nichts bedrohte. In dieser steilen Wand befand sich eine kleine Vertiefung, als wäre es der Eingang zu einer Höhle, aber es gab weder eine Höhle noch einen Eingang zum Felsen dahinter.
Auf dieser grünen Lichtung, direkt neben der Senke, beschloss ich, mein Zelt aufzuschlagen. Die Fläche war nicht mehr als hundert Meter breit und zweihundert Meter lang, sodass sie wie ein Rasen wirkte, der sich vor meinem Haus erstreckte; Am Ende fiel der Berg in unregelmäßigen Felsvorsprüngen in ein Tiefland bis zum Meeresufer ab. Diese Ecke befand sich am nordwestlichen Hang des Hügels. Somit würde es den ganzen Tag im Schatten liegen, bis zum Abend, wenn die Sonne nach Südwesten wandert, d. h. kurz vor Sonnenuntergang (ich meine in diesen Breitengraden).
Bevor ich das Zelt aufstellte, beschrieb ich vor der Vertiefung einen Halbkreis mit einem Radius von zehn Metern, also zwanzig Metern Durchmesser. Dann füllte ich entlang des gesamten Halbkreises zwei Reihen starker Pfähle und trieb sie tief in den Boden. Ich habe die Spitzen der Pfähle geschärft. Mein Lattenzaun war etwa 1,5 Meter hoch. Ich habe zwischen den beiden Pfahlreihen nicht mehr als 15 cm Platz gelassen.
Diese gesamte Lücke zwischen den Pfählen füllte ich bis ganz nach oben mit Seilresten aus, die ich vom Schiff mitgenommen hatte, stapelte sie in Reihen übereinander und verstärkte den Zaun von innen mit Stützen, für die ich dickere und kürzere Pfähle vorbereitete (ungefähr zweieinhalb Fuß lang). Mein Zaun erwies sich als solide: Weder Mensch noch Tier konnten hindurchkriechen oder hindurchkommen. Diese Arbeit erforderte von mir viel Zeit und Arbeit; Besonders schwierig war das Schneiden der Pfähle im Wald, deren Transport zur Baustelle und das Eintreiben in den Boden. Um diesen umzäunten Ort zu betreten, baute ich keine Tür, sondern eine kurze Treppe durch eine Palisade; Als ich mein Zimmer betrat, entfernte ich die Treppe. Somit war ich meiner Meinung nach völlig isoliert und gestärkt von der Außenwelt und habe nachts ruhig geschlafen, was unter anderen Bedingungen für mich unmöglich gewesen wäre. Später stellte sich jedoch heraus, dass es nicht nötig war, so viele Vorsichtsmaßnahmen gegen die von meiner Fantasie geschaffenen Feinde zu treffen.
Mit unglaublicher Mühe schleppte ich meinen ganzen Reichtum zu meinem Zaun oder meiner Festung; Proviant, Waffen und andere aufgeführte Gegenstände. Dann habe ich darin ein großes Zelt aufgebaut. Um mich vor den Regenfällen zu schützen, die in tropischen Ländern zu bestimmten Jahreszeiten sehr stark ausfallen können, baute ich ein Doppelzelt, das heißt, ich baute zunächst ein kleineres Zelt auf und stellte darüber ein größeres auf, das ich abdeckte oben mit einer Plane, die ich erbeutet hatte. vom Schiff zusammen mit den Segeln.
Jetzt schlief ich nicht mehr auf einer direkt auf den Boden geworfenen Matte, sondern in einer sehr bequemen Hängematte, die unserem Kapitänsmaaten gehörte.
Ich trug alle Lebensmittelvorräte ins Zelt und überhaupt alles, was durch den Regen verdorben werden konnte. Als alle Dinge auf diese Weise innerhalb des Zauns gestapelt waren, verschloss ich den bis dahin offen gehaltenen Eingang dicht und begann, wie oben bereits erwähnt, über die Leiter einzusteigen.
Nachdem ich den Zaun versiegelt hatte, begann ich, eine Höhle in den Berg zu graben. Ich schleppte die ausgegrabenen Steine und die Erde durch das Zelt in den Hof und machte daraus eine Art Damm innerhalb des Zauns, so dass die Erde im Hof einen halben Fuß anstieg. Die Höhle lag direkt hinter dem Zelt und diente mir als Keller.
Es dauerte viele Tage und viel Arbeit, um all diese Arbeiten abzuschließen. In dieser Zeit beschäftigten mich viele andere Dinge und es ereigneten sich mehrere Vorfälle, die ich erzählen möchte. Eines Tages, als ich gerade dabei war, ein Zelt aufzubauen und eine Höhle zu graben, zog plötzlich eine dicke Wolke auf und es regnete in Strömen. Dann zuckte ein Blitz und ein schrecklicher Donnerschlag war zu hören. Daran war natürlich nichts Ungewöhnliches, und ich hatte weniger Angst vor dem Blitz selbst als vielmehr vor dem Gedanken, der mir schneller als der Blitz durch den Kopf schoss: „Mein Schießpulver!“ Mein Herz sank, als ich dachte, dass mein gesamtes Schießpulver durch einen einzigen Blitzeinschlag zerstört werden könnte, und doch hing nicht nur meine persönliche Verteidigung, sondern auch die Fähigkeit, Nahrung für mich selbst zu beschaffen, davon ab. Es kam mir gar nicht in den Sinn, welcher Gefahr ich selbst im Falle einer Explosion ausgesetzt war, obwohl ich es wahrscheinlich nie gewusst hätte, wenn das Schießpulver explodiert wäre.
Dieser Vorfall beeindruckte mich so sehr, dass ich, sobald das Gewitter aufgehört hatte, alle Arbeiten zur Einrichtung und Verstärkung meines Hauses für eine Weile beiseite legte und begann, Taschen und Kisten für Schießpulver anzufertigen. Ich beschloss, es in Teile aufzuteilen und nach und nach an verschiedenen Orten aufzubewahren, damit sich auf keinen Fall alles auf einmal entzünden konnte und die Teile selbst sich nicht gegenseitig entzünden konnten. Für diesen Job habe ich fast zwei Wochen gebraucht. Insgesamt hatte ich etwa zweihundertvierzig Pfund Schießpulver. Ich packe alles in Tüten und Kartons und teile es in mindestens hundert Teile. Ich versteckte die Säcke und Kisten in den Felsspalten an Stellen, wo keine Feuchtigkeit eindringen konnte, und markierte jede Stelle sorgfältig. Ich hatte keine Angst vor dem Fass mit dem nassen Schießpulver, also stellte ich es sozusagen in meine Höhle oder „Küche“, wie ich es im Geiste nannte.
Während ich mit dem Bau meines Zauns beschäftigt war, ging ich mindestens einmal am Tag mit einer Waffe aus dem Haus, teils aus Spaß, teils, um Wild zu schießen und mich mit den natürlichen Ressourcen der Insel vertrauter zu machen. Bei meinem ersten Spaziergang machte ich die Entdeckung, dass es auf der Insel Ziegen gab. Darüber habe ich mich sehr gefreut, aber das Problem war, dass diese Ziegen furchtbar wild, empfindlich und beweglich waren, sodass es fast unmöglich war, sich an sie anzuschleichen. Dies störte mich jedoch nicht; Ich war mir sicher, dass ich früher oder später lernen würde, sie zu jagen. Als ich die Orte ausfindig machte, an denen sie sich normalerweise versammelten, fiel mir Folgendes auf: Als sie auf dem Berg waren und ich unter ihnen im Tal erschien, lief die ganze Herde voller Angst vor mir davon; aber wenn es passierte, dass ich auf dem Berg war und die Ziegen im Tal grasten, dann bemerkten sie mich nicht. Dies führte mich zu dem Schluss, dass die Augen dieser Tiere nicht dazu geeignet sind, nach oben zu schauen, und dass sie daher oft nicht sehen, was sich über ihnen befindet. Von da an fing ich an, an dieser Methode festzuhalten: Ich kletterte immer zuerst auf einen Felsen, um über ihnen zu sein, und dann gelang es mir oft, sie abzuschießen. Mit dem ersten Schuss habe ich eine Ziege getötet; mit dem es einen Trottel gab. Die kleine Ziege tat mir aus tiefstem Herzen leid. Als seine Mutter fiel, stand er weiterhin still in der Nähe. Als ich mich der getöteten Ziege näherte, sie auf meine Schultern legte und nach Hause trug, rannte der Junge außerdem hinter mir her. Also kamen wir zum Haus. Am Zaun legte ich die Ziege auf den Boden, nahm das Junge in die Hand und verpflanzte es durch die Palisade. Ich hoffte, ihn großzuziehen und zu zähmen, aber er wusste noch nicht, wie man isst, und ich musste ihn töten und essen. Das Fleisch dieser beiden Tiere reichte mir lange, weil ich wenig aß und versuchte, so viel wie möglich meine Vorräte, insbesondere Brot, zu schonen.
Nachdem ich mich endlich in meinem neuen Zuhause eingelebt hatte, bestand für mich die dringendste Aufgabe darin, eine Art Feuerstelle einzurichten, in der ich ein Feuer machen konnte. Es war auch notwendig, sich mit Brennholz einzudecken. Ich werde ausführlich darüber sprechen, wie ich diese Aufgabe gemeistert habe, wie ich meinen Keller vergrößert habe und wie ich mich nach und nach mit einigen Annehmlichkeiten umgeben habe, aber jetzt möchte ich über mich selbst sprechen und erzählen, welche Gedanken ich damals hatte wurde besucht. Und natürlich gab es viele davon.
Meine Situation erschien mir im dunkelsten Licht. Ich wurde von einem Sturm auf eine unbewohnte Insel geschleudert, die weit vom Ziel unseres Schiffes und mehrere hundert Meilen von den üblichen Handelsschifffahrtsrouten entfernt lag, und ich hatte allen Grund zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass es so vom Himmel bestimmt war, dass hier , an diesem traurigen Ort, in dem ich meine Tage in der hoffnungslosen Melancholie der Einsamkeit beendete. Aus meinen Augen flossen reichlich Tränen. Als ich darüber nachdachte und mich mehr als einmal fragte, warum die Vorsehung ihre eigenen Schöpfungen zerstört, sie dem Schicksal überlässt, sie ohne jede Unterstützung zurücklässt und sie so hoffnungslos unglücklich macht, sie in solche Verzweiflung stürzt, dass man kaum dankbar sein kann für so ein Leben.
Doch jedes Mal stoppte eine innere Stimme schnell diese Gedanken in mir und machte mir dafür Vorwürfe. An einen solchen Tag erinnere ich mich besonders. Tief in Gedanken wanderte ich mit einer Waffe am Meeresufer entlang. Ich dachte an mein bitteres Schicksal. Und plötzlich sprach die Stimme der Vernunft zu mir. „Ja“, sagte diese Stimme, „Ihre Position ist nicht beneidenswert: Sie sind allein – das stimmt. Aber denken Sie daran: Wo sind diejenigen, die bei Ihnen waren? Immerhin sind elf von Ihnen ins Boot gestiegen: Wo sind die anderen zehn? Warum.“ Sind sie gestorben? Warum bevorzugen Sie so etwas? Und wer ist Ihrer Meinung nach besser: Sie oder sie?“ Und ich schaute aufs Meer. Man kann also in jedem Übel etwas Gutes finden, man muss nur daran denken, dass etwas Schlimmeres passieren könnte.
Dann stellte ich mir deutlich vor, wie gut ich mich mit allem Notwendigen versorgt hatte und was mit mir passiert wäre, wenn es passiert wäre (und von hundert Mal passiert das neunundneunzig Mal) ... wenn es passiert wäre, dass unser Schiff geblieben wäre Auf der Sandbank, wo es zuerst angespült wurde, wäre es dann nicht so nah ans Ufer gefahren worden, dass ich es geschafft habe, alle Dinge zu ergattern, die ich brauchte. Was würde mit mir geschehen, wenn ich auf dieser Insel unter den Bedingungen leben müsste, unter denen ich die erste Nacht dort verbracht habe – ohne Obdach, ohne Nahrung und ohne die Möglichkeit, irgendetwas davon zu bekommen? Insbesondere“, überlegte ich mir laut, „was würde ich ohne Waffe und ohne Anklage, ohne Werkzeug tun? Wie könnte ich hier allein leben, wenn ich weder ein Bett, noch ein Kleidungsstück, noch ein Zelt hätte, in dem ich mich verstecken könnte? Jetzt hatte ich das alles und zwar in Hülle und Fülle, und ich hatte nicht einmal Angst davor, in die Augen der Zukunft zu blicken: Ich wusste, dass ich, wenn meine Ladungen und mein Schießpulver herauskamen, ein anderes Mittel zur Nahrungsbeschaffung in meinen Händen haben würde ich selbst. Ich werde erträglich ohne Waffe leben, bis ich sterbe.
Tatsächlich beschloss ich von den ersten Tagen meines Lebens auf der Insel an, mich mit allem Notwendigen für die Zeit zu versorgen, in der nicht nur mein gesamter Vorrat an Schießpulver und Ladungen erschöpft sein würde, sondern auch meine Gesundheit und Kraft zu versagen beginnen würden .
Ich gestehe: Ich habe völlig aus den Augen verloren, dass meine Waffenreserven mit einem Schlag zerstört werden könnten, dass ein Blitz mein Schießpulver entzünden und explodieren könnte. Deshalb war ich so erstaunt, als mir dieser Gedanke während eines Gewitters durch den Kopf schoss.
Ich beginne nun mit der detaillierten Beschreibung des stillsten und traurigsten Lebens, das jemals einem Sterblichen widerfahren ist. Ich beginne ganz am Anfang und werde es der Reihe nach erzählen.
Nach meiner Zählung war es der 30. September, als ich zum ersten Mal einen Fuß auf die schreckliche Insel setzte. Dies geschah also während der Herbst-Tagundnachtgleiche; Auf den gleichen Breitengraden (d. h. nach meinen Berechnungen 9–22 Zoll nördlich des Äquators) steht die Sonne diesen Monat fast senkrecht über mir.
Zehn bis zwanzig Tage meines Lebens auf der Insel vergingen, und mir wurde plötzlich klar, dass ich aufgrund des Mangels an Büchern, Stiften und Tinte das Zeitgefühl verlieren und am Ende sogar nicht mehr zwischen Wochentagen und Sonntagen unterscheiden würde. Um dies zu verhindern, errichtete ich an der Stelle des Ufers, an der mich das Meer hinausgeworfen hatte, einen großen Holzpfahl und ritzte mit einem Messer in großen Buchstaben die Inschrift ein: „Hier betrat ich dieses Ufer am 30. September 1659.“ „, das ich quer an die Stange genagelt habe. Jeden Tag habe ich mit einem Messer eine Kerbe in die Seiten dieser Säule gemacht; und alle sechs Kerben machte er eine länger: das bedeutete Sonntag; Ich habe die Kerben, die den ersten Tag jedes Monats markierten, noch länger gemacht. Also führte ich meinen Kalender und notierte Tage, Wochen, Monate und Jahre.
Bei der Auflistung der Gegenstände, die ich, wie bereits gesagt, in mehreren Etappen vom Schiff transportiert habe, habe ich viele kleine Dinge nicht erwähnt, die zwar nicht besonders wertvoll sind, mir aber dennoch gute Dienste geleistet haben. So fand ich beispielsweise in den Gemächern des Kapitäns und des Kapitänsmaat Tinte, Stifte und Papier, drei oder vier Kompasse, einige astronomische Instrumente, Teleskope, geografische Karten und Bücher über die Navigation. Ich habe das alles für alle Fälle in eine der Truhen gelegt, ohne zu wissen, ob ich eines dieser Dinge brauchen würde. Außerdem befanden sich in meinem eigenen Gepäck drei sehr gute Bibeln (ich bekam sie zusammen mit den bestellten Waren aus England und packte sie, als ich auf die Reise ging, zu meinen Sachen). Dann stieß ich auf mehrere Bücher auf Portugiesisch, darunter drei katholische Gebetbücher und mehrere andere Bücher. Ich habe sie auch abgeholt. Dann muss ich noch erwähnen, dass wir zwei Katzen und einen Hund auf dem Schiff hatten (ich werde zu gegebener Zeit die kuriose Geschichte des Lebens dieser Tiere auf der Insel erzählen). Ich transportierte die Katzen auf einem Floß ans Ufer, aber der Hund sprang bei meiner ersten Expedition zum Schiff ins Wasser und schwamm hinter mir her. Viele Jahre lang war sie meine treue Kameradin und Dienerin. Sie tat alles für mich und ersetzte für mich fast die menschliche Gesellschaft. Ich wünschte nur, sie könnte reden. Aber dies wurde ihr nicht gegeben. Wie bereits gesagt, habe ich Federn, Tinte und Papier vom Schiff mitgenommen. Ich habe sie so weit wie möglich gespeichert und solange ich Tinte hatte, habe ich sorgfältig alles aufgeschrieben, was mir passiert ist; Aber als sie herauskamen, musste ich mit dem Schreiben aufhören, da ich nicht wusste, wie man Tinte herstellt, und mir nichts einfiel, durch das ich sie ersetzen könnte.
Im Allgemeinen fehlte mir trotz meines riesigen Lagers an allen möglichen Dingen außer Tinte immer noch eine Menge Dinge; Ich hatte weder eine Schaufel, noch einen Spaten, noch eine Spitzhacke, also gab es nichts, womit ich graben oder den Boden auflockern konnte, es gab keine Nadeln und Fäden. Ich hatte nicht einmal Unterwäsche, aber ich lernte bald, ohne große Entbehrungen darauf zu verzichten.
Aufgrund des Mangels an Werkzeugen waren alle Arbeiten für mich langsam und schwierig. Es hat fast ein ganzes Jahr gedauert, bis ich den Zaun fertiggestellt hatte, mit dem ich mein Haus umgeben wollte. Hacken Sie dicke Stangen aus dem Wald, schneiden Sie Pfähle daraus und ziehen Sie sie. Diese Heringe für mein Zelt – das alles hat viel Zeit gekostet. Die Pfähle waren sehr schwer, so dass ich nicht mehr als einen auf einmal heben konnte, und manchmal brauchte ich zwei Tage, um den Pfahl zuzuschneiden und nach Hause zu bringen, und einen dritten Tag, um ihn in den Boden zu rammen. Für diese letzte Arbeit benutzte ich zunächst einen schweren Holzknüppel, dann erinnerte ich mich an die eisernen Brecheisen, die ich vom Schiff mitgebracht hatte, und ersetzte den Knüppel durch ein Brecheisen, obwohl ich nicht sagen möchte, dass mir das viel Erleichterung brachte. Generell war das Eintreiben von Pfählen für mich eine der mühsamsten und mühsamsten Arbeiten.
Aber das war mir nicht peinlich, da ich sowieso keine Zeit hatte, wo ich meine Zeit aufbringen konnte; Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen waren, hatte ich keine andere Aufgabe mehr in Sicht, als auf der Suche nach Nahrung auf der Insel herumzuwandern, der ich mich jeden Tag mehr oder weniger hingab.
In der Zwischenzeit begann ich, meine Situation ernsthaft und gründlich zu besprechen und begann, meine Gedanken aufzuschreiben – nicht, um sie zur Erbauung der Menschen zu verewigen, die sich in meiner Lage befinden würden (denn es würde kaum viele solcher Menschen geben), sondern einfach alles, was mich quälte und quälte, in Worte zu fassen und dadurch meine Seele zumindest irgendwie zu beruhigen. Aber so schmerzhaft meine Gedanken auch waren, nach und nach siegte meine Vernunft über die Verzweiflung. Soweit es mir möglich war, versuchte ich mich damit zu trösten, dass Schlimmeres hätte passieren können, und stellte das Gute dem Bösen gegenüber. Mit völliger Unparteilichkeit, wie ein Gläubiger und ein Schuldner, schrieb ich alle Sorgen auf, die ich erlitten hatte, und neben allem, was mir an Freude widerfuhr.
Das Schicksal hat mich auf einer düsteren, unbewohnten Insel zurückgelassen und habe keine Hoffnung auf Befreiung.
Aber ich lebe, ich bin nicht ertrunken wie alle meine Kameraden.
Ich scheine isoliert und von der ganzen Welt abgeschnitten und zum Kummer verdammt zu sein.
Aber dann werde ich aus unserer gesamten Crew herausgegriffen; Der Tod hat mich allein verschont, und derjenige, der mich auf wundersame Weise vor dem Tod gerettet hat, kann mich aus meiner trostlosen Situation retten.
Ich bin von der ganzen Menschheit fern; Ich bin ein Einsiedler, aus der menschlichen Gesellschaft verbannt.
Aber ich bin an diesem verlassenen Ort, an dem der Mensch nichts zu essen hat, nicht verhungert und nicht umgekommen.
Ich habe wenig Kleidung und bald werde ich nichts mehr haben, um meinen Körper zu bedecken.
Aber ich lebe in einem heißen Klima, in dem ich ohne Kleidung auskomme.
Gegen Angriffe von Menschen und Tieren bin ich wehrlos.
Aber die Insel, auf der ich landete, war verlassen, und ich sah darauf kein einziges Raubtier wie an den Küsten Afrikas. Was würde mit mir passieren, wenn ich an der afrikanischen Küste angespült würde?
Ich habe niemanden, mit dem ich ein Wort wechseln kann, und niemanden, der mich tröstet.
Aber Gott trieb unser Schiff auf wundersame Weise so nah an die Küste, dass es mir nicht nur gelang, mich mit allem Notwendigen einzudecken, um meine aktuellen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch die Möglichkeit hatte, bis ans Ende meiner Tage etwas zu essen zu verdienen.
Diese Aufzeichnung zeigt deutlich, dass sich kaum jemand auf der Welt in einer desaströseren Situation befand, und doch enthielt sie sowohl negative als auch positive Seiten, für die man dankbar sein sollte – das zeigt die bittere Erfahrung eines Menschen, der das schlimmste Unglück der Welt erlebt hat dass wir immer einen Trost haben, der in der Gemeinde bei der Berechnung unserer Nöte und Segnungen vermerkt werden sollte.
Nachdem ich also auf die Stimme der Vernunft gehört hatte, begann ich, mich mit meiner Situation auseinanderzusetzen. Früher habe ich ständig auf das Meer geschaut, in der Hoffnung, dass irgendwo ein Schiff auftauchen würde; Jetzt habe ich bereits vergeblichen Hoffnungen ein Ende gesetzt und alle meine Gedanken darauf gerichtet, mir das Leben so einfach wie möglich zu machen.
Mein Zuhause habe ich bereits beschrieben. Es war ein Zelt, das am Berghang aufgestellt und von einer Palisade umgeben war. Aber jetzt könnte man meinen Zaun eher als Mauer bezeichnen, denn dicht daneben, an der Außenseite, baute ich einen etwa zwei Fuß dicken Erddamm. Und nach einiger Zeit (soweit ich mich erinnere, etwa anderthalb Jahre später) stellte ich Stangen auf die Böschung, lehnte sie an den Hang und bedeckte sie mit Ästen und großen Blättern. So war mein Hof überdacht, und ich konnte mich vor den Regenfällen nicht fürchten, die, wie ich bereits sagte, zu bestimmten Jahreszeiten ununterbrochen auf meiner Insel niedergingen.
Ich habe bereits erwähnt, dass ich alle meine Waren in meinen Zaun und in die Höhle gebracht habe, die ich hinter dem Zelt gegraben habe. Aber ich muss anmerken, dass die Dinge zunächst willkürlich auf einem Haufen aufgetürmt waren und das gesamte Gebiet überfüllten, so dass ich nirgendwo hingehen konnte. Vor diesem Hintergrund beschloss ich, meine Höhle zu vergrößern. Dies war nicht schwierig, da der Berg aus lockerem, sandigem Gestein bestand, das meinen Bemühungen leicht nachgab. Als ich sah, dass mir keine Gefahr durch Raubtiere drohte, begann ich mit der Erweiterung der Höhle. Nachdem ich seitlich, nämlich nach rechts, so viel gegraben hatte, wie nach meinen Berechnungen nötig war, bog ich wieder nach rechts ab und führte den Durchgang über die Grenzen meiner Befestigung hinaus.
Diese Galerie diente nicht nur als Hintertür zu meinem Zelt und gab mir die Freiheit, das Zelt zu verlassen und zurückzukehren, sondern vergrößerte auch meinen Lagerraum erheblich.
Nachdem ich diese Arbeit abgeschlossen hatte, machte ich mich daran, die notwendigsten Möbelstücke herzustellen, zunächst einen Tisch und einen Stuhl: Ohne sie könnte ich selbst die bescheidenen Freuden, die mir auf Erden erlaubt waren, nicht in vollem Umfang genießen, ich konnte weder essen noch schreiben mit vollem Komfort.
Und so begann ich mit der Schreinerei. Hier muss ich anmerken, dass die Vernunft die Grundlage und Quelle der Mathematik ist und dass daher jeder nach einer gewissen Zeit jedes Handwerk beherrschen kann, indem er Dinge mit Vernunft definiert und misst und das vernünftigste Urteil darüber fällt. Noch nie in meinem Leben hatte ich ein Zimmermannswerkzeug in die Hand genommen, und doch wurde ich dank harter Arbeit und Fleiß nach und nach so geschickt, dass ich sicher alles tun konnte, besonders wenn ich Werkzeug hatte. Aber auch ohne Werkzeug oder fast ohne Werkzeug, nur mit einer Axt und einem Hobel, habe ich viele Gegenstände hergestellt, obwohl sie wahrscheinlich noch nie jemand auf diese Weise hergestellt und nicht so viel Arbeit darauf verwendet hatte. Wenn ich zum Beispiel ein Brett brauchte, musste ich einen Baum fällen, den Stamm von Ästen befreien und ihn, indem ich ihn vor mich legte, auf beiden Seiten beschneiden, bis er die gewünschte Form annahm. Und dann musste das Brett mit einem Hobel gehobelt werden. Allerdings kam mit dieser Methode nur ein Brett aus einem ganzen Baum heraus, und die Herstellung dieses Bretts hat mich viel Zeit und Arbeit gekostet. Aber ich hatte nur ein Mittel dagegen: Geduld. Außerdem waren meine Zeit und meine Arbeitskraft günstig, und war es daher wirklich wichtig, wo und wofür sie hingingen?
Also habe ich mir zunächst einen Tisch und einen Stuhl gemacht. Ich habe dafür kurze Bretter verwendet, die ich auf einem Floß vom Schiff mitgebracht hatte. Als ich dann auf die oben beschriebene Weise lange Bretter behauen habe, habe ich an einer Wand meines Kellers mehrere Regale übereinander angebracht, anderthalb Fuß breit, und darauf meine Werkzeuge, Nägel, Eisen und andere Kleinigkeiten abgelegt – Kurz gesagt, ich habe alles nach Orten verteilt, um jeden Artikel leicht zu finden. Ich habe auch Pflöcke in die Kellerwand gehämmert und meine Waffen und überhaupt alles, was man aufhängen konnte, daran aufgehängt.
Wer danach meine Höhle sah, würde sie wahrscheinlich für ein Lagerhaus für Grundbedürfnisse halten. Ich hatte alles zur Hand und es machte mir große Freude, in dieses Lagerhaus zu blicken: Dort herrschte so eine vorbildliche Ordnung und es gab so viel Gutes.
Erst nachdem ich diese Arbeit beendet hatte, begann ich, mein Tagebuch zu führen und alles aufzuschreiben, was ich tagsüber getan hatte. Anfangs war ich so beschäftigt und so deprimiert, dass sich meine düstere Stimmung unweigerlich in meinem Tagebuch widerspiegelte. Hier ist zum Beispiel der Eintrag, den ich am 30. September machen müsste:
„Als ich am Ufer ankam und mich so vor dem Tod rettete, erbrach ich mich heftig mit Salzwasser, das ich geschluckt hatte. Nach und nach kam ich zur Besinnung, aber anstatt dem Schöpfer für meine Erlösung zu danken, begann ich mitzulaufen Ich rang verzweifelt am Ufer. Ich rang meine Hände, schlug mir auf den Kopf und ins Gesicht und schrie wie wild: „Ich bin verloren, ich bin verloren!“ – bis ich erschöpft zu Boden fiel. Aber ich tat es Ich schließe meine Augen nicht, aus Angst, dass wilde Tiere mich in Stücke reißen würden.
Noch viele Tage danach (nach all meinen Ausflügen zum Schiff, als ihm alle Sachen weggenommen wurden) rannte ich den Hügel hinauf und blickte auf das Meer in der Hoffnung, am Horizont ein Schiff zu sehen. Wie oft kam es mir vor, als wäre in der Ferne ein weißes Segel, und ich schwelgte in freudigen Hoffnungen! Ich schaute und schaute, bis meine Sicht verschwamm, dann warf ich mich in Verzweiflung auf den Boden und weinte wie ein Kind, was mein Unglück nur durch meine eigene Dummheit verschlimmerte.
Aber als ich mich endlich einigermaßen beherrschte, mein Zuhause einrichtete, meine Haushaltsgegenstände in Ordnung brachte, mir einen Tisch und einen Stuhl herstellte und mich im Allgemeinen mit allem Komfort einrichtete, den ich nur konnte, machte ich mich an die Arbeit an meinem Tagebuch . Ich stelle es hier vollständig vor, obwohl die darin beschriebenen Ereignisse dem Leser bereits aus früheren Kapiteln bekannt sind. Ich habe es behalten, solange ich Tinte hatte, aber als es herauskam, musste ich das Tagebuch beenden.
Daniel Defoe – ROBINSON CRUSOE. 02., lies den Text
Siehe auch Daniel Defoe – Prosa (Geschichten, Gedichte, Romane...):
ROBINSON CRUSOE. 03.
TAGEBUCH 30. September 1659. - Ich, unglücklicher Robinson Crusoe, habe verloren...
ROBINSON CRUSOE. 04.
Dann bestieg ich das Schiff. Das erste, was ich sah, waren zwei Leichen;...
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Familie Robinson. – Seine Flucht aus dem Haus seiner Eltern
Seit meiner frühen Kindheit liebte ich das Meer mehr als alles andere auf der Welt. Ich beneidete jeden Seemann, der sich auf eine lange Reise begab. Stundenlang stand ich am Meeresufer und ließ die vorbeifahrenden Schiffe nicht aus den Augen.
Meinen Eltern gefiel es nicht besonders. Mein Vater, ein alter, kranker Mann, wollte, dass ich ein wichtiger Beamter werde, am königlichen Hof diente und ein hohes Gehalt bekäme. Aber ich habe von Seereisen geträumt. Es schien mir das größte Glück zu sein, durch die Meere und Ozeane zu wandern.
Mein Vater erriet, was mir durch den Kopf ging. Eines Tages rief er mich an und sagte wütend:
– Ich weiß: Du willst von zu Hause weglaufen. Das ist verrückt. Du musst bleiben. Wenn du bleibst, werde ich dir ein guter Vater sein, aber wehe dir, wenn du wegläufst! „Hier zitterte seine Stimme und er fügte leise hinzu:
- Denken Sie an Ihre kranke Mutter ... Sie wird die Trennung von Ihnen nicht ertragen können.
Tränen funkelten in seinen Augen. Er liebte mich und wollte das Beste für mich.
Der alte Mann tat mir leid, ich beschloss fest, im Haus meiner Eltern zu bleiben und nicht mehr an Seereisen zu denken. Aber leider! – Mehrere Tage vergingen, und von meinen guten Vorsätzen blieb nichts übrig. Es zog mich wieder an die Meeresküste. Ich begann von Masten, Wellen, Segeln, Möwen, unbekannten Ländern und den Lichtern von Leuchttürmen zu träumen.
Zwei oder drei Wochen nach meinem Gespräch mit meinem Vater beschloss ich schließlich, wegzulaufen. Da ich eine Zeit wählte, in der meine Mutter fröhlich und ruhig war, ging ich auf sie zu und sagte respektvoll:
„Ich bin bereits achtzehn Jahre alt und diese Jahre sind zu spät, um das Richten zu erlernen. Selbst wenn ich irgendwo in den Dienst eintreten würde, würde ich nach ein paar Jahren immer noch in ferne Länder fliehen. Ich möchte so gerne fremde Länder sehen, sowohl Afrika als auch Asien besuchen! Selbst wenn ich an etwas hänge, habe ich immer noch nicht die Geduld, es bis zum Ende durchzuziehen. Ich bitte Sie, meinen Vater zu überreden, mich zumindest für kurze Zeit zur Probe zur See fahren zu lassen; Wenn mir das Leben als Seemann nicht gefällt, werde ich nach Hause zurückkehren und nie woanders hingehen. Mein Vater soll mich freiwillig gehen lassen, sonst bin ich gezwungen, das Haus ohne seine Erlaubnis zu verlassen.
Meine Mutter wurde sehr wütend auf mich und sagte:
„Ich bin überrascht, wie du nach deinem Gespräch mit deinem Vater über Seereisen nachdenken kannst!“ Schließlich hat dein Vater verlangt, dass du die fremden Länder ein für alle Mal vergisst. Und er versteht besser als Sie, welches Geschäft Sie machen sollten. Wenn du dich selbst zerstören willst, geh natürlich auch in dieser Minute weg, aber du kannst sicher sein, dass dein Vater und ich deiner Reise niemals zustimmen werden. Und vergebens hofften Sie, dass ich Ihnen helfen würde. Nein, ich werde meinem Vater kein Wort über deine bedeutungslosen Träume sagen. Ich möchte nicht, dass du später, wenn das Leben auf See dich in Armut und Leid bringt, deiner Mutter Vorwürfe machen könntest, dass sie dich verwöhnt.
Dann, viele Jahre später, fand ich heraus, dass meine Mutter meinem Vater dennoch unser gesamtes Gespräch Wort für Wort übermittelte. Der Vater war traurig und sagte seufzend zu ihr:
– Ich verstehe nicht, was er will? In seiner Heimat konnte er leicht Erfolg und Glück erreichen. Wir sind keine reichen Leute, aber wir haben einige Mittel. Er kann bei uns leben, ohne etwas zu brauchen. Wenn er auf eine Reise geht, wird er große Strapazen erleben und bereuen, dass er nicht auf seinen Vater gehört hat. Nein, ich kann ihn nicht zur See fahren lassen. Weit weg von seiner Heimat wird er einsam sein, und wenn ihm Ärger widerfährt, wird er keinen Freund haben, der ihn trösten könnte. Und dann wird er seine Rücksichtslosigkeit bereuen, aber es wird zu spät sein!
Und doch floh ich nach ein paar Monaten aus meiner Heimat. Es ist so passiert. Eines Tages fuhr ich für mehrere Tage in die Stadt Gull. Dort traf ich einen Freund, der mit dem Schiff seines Vaters nach London fahren wollte. Er begann mich zu überreden, mit ihm zu gehen, indem er mich mit der Tatsache in Versuchung führte, dass die Fahrt mit dem Schiff kostenlos sein würde.
Und so, ohne Vater oder Mutter zu fragen, zu einer unfreundlichen Stunde! - Am 1. September 1651, in meinem neunzehnten Lebensjahr, bestieg ich ein Schiff nach London.
Es war eine schlimme Tat: Ich habe meine alten Eltern schamlos im Stich gelassen, ihren Rat missachtet und meine kindliche Pflicht verletzt. Und ich musste sehr bald bereuen, was ich getan hatte.
Erste Abenteuer auf See
Kaum hatte unser Schiff die Mündung des Humber verlassen, wehte ein kalter Wind aus Norden. Der Himmel war mit Wolken bedeckt. Es begann eine kräftige Schaukelbewegung.
Ich war noch nie zuvor auf See gewesen und fühlte mich schlecht. Mein Kopf begann sich zu drehen, meine Beine begannen zu zittern, mir wurde übel und ich wäre fast gestürzt. Jedes Mal, wenn eine große Welle das Schiff traf, kam es mir vor, als würden wir sofort ertrinken. Jedes Mal, wenn ein Schiff von einem hohen Wellenkamm fiel, war ich mir sicher, dass es nie wieder aufstehen würde.
Tausendmal habe ich geschworen, dass ich, wenn ich am Leben bleibe, wenn ich wieder festen Boden betrete, sofort nach Hause zu meinem Vater zurückkehren und in meinem ganzen Leben nie wieder einen Fuß auf das Deck eines Schiffes setzen würde.
Diese klugen Gedanken hielten nur so lange an, wie der Sturm tobte.
Aber der Wind ließ nach, die Aufregung ließ nach und ich fühlte mich viel besser. Nach und nach gewöhnte ich mich an das Meer. Zwar hatte ich mich noch nicht ganz von der Seekrankheit erholt, aber am Ende des Tages hatte sich das Wetter aufgeklärt, der Wind hatte völlig nachgelassen und ein herrlicher Abend war angebrochen.
Ich habe die ganze Nacht tief und fest geschlafen. Am nächsten Tag war der Himmel genauso klar. Das ruhige Meer mit völliger Ruhe, alles von der Sonne beleuchtet, bot ein so schönes Bild, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Von meiner Seekrankheit war keine Spur mehr übrig. Ich beruhigte mich sofort und fühlte mich glücklich. Überrascht schaute ich mich auf dem Meer um, das gestern noch gewalttätig, grausam und bedrohlich wirkte, heute aber so sanft und sanft war.
Dann kommt wie mit Absicht mein Freund, der mich dazu verleitet hat, mit ihm zu gehen, auf mich zu, klopft mir auf die Schulter und sagt:
- Na, wie fühlst du dich, Bob? Ich wette, du hattest Angst. Geben Sie es zu: Sie hatten gestern große Angst, als der Wind wehte?
- Gibt es eine Brise? Schöne Brise! Es war ein toller Sturm. Ich könnte mir einen so schrecklichen Sturm gar nicht vorstellen!
- Stürme? Oh, du Narr! Glaubst du, das ist ein Sturm? Nun ja, Sie sind noch neu am Meer: Kein Wunder, dass Sie Angst haben ... Auf geht's, bestellen wir Punsch, trinken ein Glas und vergessen den Sturm. Schauen Sie, wie klar der Tag ist! Herrliches Wetter, nicht wahr? Um diesen traurigen Teil meiner Geschichte abzukürzen, möchte ich nur sagen, dass es bei Seeleuten wie immer lief: Ich betrank mich und ertränkte alle meine Versprechen und Schwüre, alle meine lobenswerten Gedanken über die sofortige Rückkehr nach Hause im Wein. Sobald die Ruhe kam und ich keine Angst mehr hatte, dass die Wellen mich verschlucken würden, vergaß ich sofort alle meine guten Vorsätze.

Am sechsten Tag sahen wir in der Ferne die Stadt Yarmouth. Der Wind war nach dem Sturm Gegenwind, so dass wir sehr langsam vorankamen. In Yarmouth mussten wir vor Anker gehen. Wir standen sieben oder acht Tage lang da und warteten auf einen guten Wind.
In dieser Zeit kamen viele Schiffe aus Newcastle hierher. Wir hätten allerdings nicht so lange ausgehalten und wären mit der Flut in den Fluss gegangen, aber der Wind wurde frischer und nach fünf Tagen wehte er mit aller Kraft. Da die Anker und Ankertaue auf unserem Schiff stark waren, zeigten unsere Matrosen nicht die geringste Beunruhigung. Sie waren davon überzeugt, dass das Schiff absolut sicher war, und widmeten, wie es unter Seeleuten üblich war, ihre gesamte Freizeit lustigen Aktivitäten und Vergnügungen.
Doch am Morgen des neunten Tages wurde der Wind noch frischer und bald brach ein schrecklicher Sturm aus. Sogar die erfahrenen Segler hatten große Angst. Mehrmals hörte ich, wie unser Kapitän mich in die Kabine hinein- und hinausging und mit leiser Stimme murmelte: „Wir sind verloren!“ Wir sind verloren! Ende!"
Dennoch verlor er nicht den Kopf, beobachtete aufmerksam die Arbeit der Matrosen und ergriff alle Maßnahmen, um sein Schiff zu retten.
Bisher hatte ich keine Angst verspürt: Ich war mir sicher, dass dieser Sturm genauso sicher vorübergehen würde wie der erste. Doch als der Kapitän selbst verkündete, dass das Ende für uns alle gekommen sei, bekam ich schreckliche Angst und rannte aus der Kabine auf das Deck. Noch nie in meinem Leben habe ich einen so schrecklichen Anblick gesehen. Riesige Wellen bewegten sich wie hohe Berge über das Meer, und alle drei oder vier Minuten stürzte ein solcher Berg auf uns.
Zuerst war ich taub vor Angst und konnte mich nicht umsehen. Als ich es endlich wagte, zurückzublicken, wurde mir klar, was für eine Katastrophe über uns hereingebrochen war. Bei zwei schwer beladenen Schiffen, die in der Nähe vor Anker lagen, kappten die Matrosen die Masten, um die Schiffe zumindest ein wenig von ihrem Gewicht zu entlasten.
Zwei weitere Schiffe verloren ihre Anker und wurden vom Sturm aufs Meer hinausgetragen. Was erwartete sie dort? Alle ihre Masten wurden durch den Hurrikan umgeworfen.
Kleinere Schiffe hielten sich besser, aber einige von ihnen mussten auch leiden: Zwei oder drei Boote trieben an unserer Seite vorbei direkt ins offene Meer.
Am Abend kamen der Navigator und der Bootsmann zum Kapitän und sagten ihm, dass es zur Rettung des Schiffes notwendig sei, den Fockmast abzuschneiden.
– Sie können keine Minute zögern! - Sie sagten. - Geben Sie die Bestellung auf und wir werden sie kürzen.
„Lass uns noch ein bisschen warten“, wandte der Kapitän ein. „Vielleicht lässt der Sturm nach.“
Eigentlich wollte er den Mast nicht durchtrennen, aber der Bootsmann begann zu argumentieren, dass das Schiff sinken würde, wenn der Mast übrig bliebe – und der Kapitän stimmte widerwillig zu.
Und als der Fockmast abgeholzt wurde, begann der Großmast zu schwanken und das Schiff so stark zu schaukeln, dass auch er abgeholzt werden musste.
Die Nacht brach herein, und plötzlich schrie einer der Matrosen, als er in den Laderaum hinabstieg, dass das Schiff ein Leck gehabt habe. Ein anderer Seemann wurde in den Laderaum geschickt und berichtete, dass das Wasser bereits einen Meter gestiegen sei.
Dann befahl der Kapitän:
- Wasser abpumpen! Alles an die Pumpen!
Als ich diesen Befehl hörte, sank mein Herz vor Entsetzen: Es kam mir vor, als würde ich sterben, meine Beine gaben nach und ich fiel rücklings auf das Bett. Aber die Matrosen drängten mich beiseite und forderten, dass ich mich meiner Arbeit nicht entziehen sollte.
- Du warst genug untätig, jetzt ist es Zeit, hart zu arbeiten! - Sie sagten.
Es gab nichts zu tun, ich ging zur Pumpe und begann fleißig Wasser abzupumpen.
Zu dieser Zeit lichteten kleine Frachtschiffe, die dem Wind nicht widerstehen konnten, die Anker und fuhren aufs offene Meer hinaus.
Als unser Kapitän sie sah, befahl er, die Kanone abzufeuern, um ihnen mitzuteilen, dass wir in Lebensgefahr schwebten. Als ich eine Kanonensalve hörte und nicht verstand, was geschah, stellte ich mir vor, dass unser Schiff abgestürzt sei. Ich hatte solche Angst, dass ich ohnmächtig wurde und fiel. Aber damals war jeder besorgt, sein eigenes Leben zu retten, und sie schenkten mir keine Beachtung. Niemand war daran interessiert herauszufinden, was mit mir passiert ist. Einer der Matrosen nahm meinen Platz an der Pumpe ein und schob mich mit dem Fuß beiseite. Alle waren sich sicher, dass ich bereits tot war. Ich lag sehr lange so da. Als ich aufwachte, machte ich mich wieder an die Arbeit. Wir arbeiteten unermüdlich, doch das Wasser im Laderaum stieg immer höher.
Es war klar, dass das Schiff sinken würde. Zwar begann der Sturm etwas nachzulassen, aber wir hatten nicht die geringste Möglichkeit, bis zur Einfahrt in den Hafen auf dem Wasser zu bleiben. Deshalb hörte der Kapitän nicht auf, seine Kanonen abzufeuern, in der Hoffnung, dass uns jemand vor dem Tod retten würde.
Schließlich wagte das kleine Schiff, das uns am nächsten war, das Risiko, ein Boot herabzulassen, um uns zu helfen. Das Boot hätte jede Minute kentern können, aber es kam trotzdem auf uns zu. Leider konnten wir nicht hinein, da es keine Möglichkeit gab, an unserem Schiff festzumachen, obwohl die Menschen mit aller Kraft ruderten und ihr Leben riskierten, um unseres zu retten. Wir warfen ihnen ein Seil zu. Sie konnten ihn lange Zeit nicht einholen, da der Sturm ihn zur Seite riss. Doch zum Glück gelang es einem der Draufgänger, sich nach vielen erfolglosen Versuchen das Seil am Ende zu schnappen. Dann zogen wir das Boot unter unser Heck und jeder einzelne von uns stieg hinein. Wir wollten zu ihrem Schiff, aber wir konnten den Wellen nicht widerstehen und die Wellen trugen uns ans Ufer. Es stellte sich heraus, dass dies die einzige Richtung war, in die man rudern konnte. Es verging keine Viertelstunde, bis unser Schiff im Wasser zu versinken begann. Die Wellen, die unser Boot hin und her trieben, waren so hoch, dass wir das Ufer nicht sehen konnten. Erst im ganz kurzen Moment, als unser Boot auf den Wellenkamm geworfen wurde, konnten wir erkennen, dass sich eine große Menschenmenge am Ufer versammelt hatte: Menschen rannten hin und her und bereiteten sich darauf vor, uns zu helfen, wenn wir näher kamen. Aber wir bewegten uns sehr langsam in Richtung Ufer. Erst am Abend gelang es uns, an Land zu gelangen, und selbst dann unter größten Schwierigkeiten.
Wir mussten nach Yarmouth laufen. Dort erwartete uns ein herzlicher Empfang: Die Einwohner der Stadt, die bereits von unserem Unglück wussten, gaben uns eine gute Unterkunft, bewirteten uns mit einem hervorragenden Abendessen und versorgten uns mit Geld, damit wir dorthin gelangen konnten, wohin wir wollten – nach London oder nach Hull .
Nicht weit von Hull entfernt lag York, wo meine Eltern lebten, und natürlich hätte ich zu ihnen zurückkehren sollen. Sie würden mir meine unerlaubte Flucht verzeihen und wir wären alle so glücklich!
Aber der verrückte Traum von Seeabenteuern ließ mich auch jetzt noch nicht los. Obwohl mir die nüchterne Stimme der Vernunft sagte, dass mich auf See neue Gefahren und Probleme erwarteten, begann ich erneut darüber nachzudenken, wie ich auf ein Schiff steigen und die Meere und Ozeane der ganzen Welt bereisen könnte.
Mein Freund (derselbe, dessen Vater das verlorene Schiff besaß) war jetzt düster und traurig. Die Katastrophe, die passierte, deprimierte ihn. Er stellte mich seinem Vater vor, der ebenfalls nicht aufhörte, über das gesunkene Schiff zu trauern. Nachdem er von meinem Sohn von meiner Leidenschaft für Seereisen erfahren hatte, sah mich der alte Mann streng an und sagte:
„Junger Mann, du solltest nie wieder zur See fahren.“ Ich habe gehört, dass du feige und verwöhnt bist und bei der geringsten Gefahr den Mut verlierst. Solche Leute sind nicht geeignet, Seeleute zu sein. Kehren Sie schnell nach Hause zurück und versöhnen Sie sich mit Ihrer Familie. Sie haben aus erster Hand erfahren, wie gefährlich es ist, auf dem Seeweg zu reisen.
Ich hatte das Gefühl, dass er Recht hatte und konnte nichts dagegen haben. Trotzdem kehrte ich nicht nach Hause zurück, weil ich mich schämte, vor meinen Lieben zu erscheinen. Es schien mir, als würden alle unsere Nachbarn mich verspotten; Ich war mir sicher, dass meine Misserfolge mich zum Gespött aller meiner Freunde und Bekannten machen würden. In der Folge ist mir oft aufgefallen, dass Menschen, insbesondere in ihrer Jugend, nicht die skrupellosen Taten für beschämend halten, für die wir sie Narren nennen, sondern die guten und edlen Taten, die sie in Momenten der Reue begehen, obwohl sie nur für diese Taten als vernünftig bezeichnet werden können . So war ich damals. Die Erinnerungen an das Unglück, das ich während des Schiffbruchs erlebte, verblassten allmählich, und nachdem ich zwei oder drei Wochen in Yarmouth gelebt hatte, ging ich nicht nach Hull, sondern nach London.
Robinson wird gefangen genommen. - Flucht
Mein großes Unglück war, dass ich bei all meinen Abenteuern nicht als Seemann an Bord des Schiffes war. Zwar müsste ich mehr arbeiten, als ich es gewohnt bin, aber am Ende würde ich Seemannschaft lernen und könnte irgendwann Navigator und vielleicht sogar Kapitän werden. Aber ich war damals so unvernünftig, dass ich von allen Wegen immer den schlechtesten gewählt habe. Da ich damals schick gekleidet war und Geld in der Tasche hatte, kam ich immer als Faulenzer auf das Schiff: Ich habe dort nichts getan und nichts gelernt.
Junge Wildfang- und Faulenzer geraten meist in schlechte Gesellschaft und verirren sich innerhalb kürzester Zeit völlig. Das gleiche Schicksal erwartete mich, aber glücklicherweise gelang es mir bei meiner Ankunft in London, einen angesehenen älteren Kapitän zu treffen, der eine große Anteilnahme an mir hatte. Kurz zuvor segelte er mit seinem Schiff an die Küste Afrikas, nach Guinea. Diese Reise brachte ihm beträchtlichen Gewinn, und nun wollte er erneut in die gleiche Region reisen.
Er mochte mich, weil ich damals ein guter Gesprächspartner war. Er verbrachte oft seine Freizeit mit mir und als er erfuhr, dass ich überseeische Länder sehen wollte, lud er mich ein, mit seinem Schiff in See zu stechen.
„Es wird dich nichts kosten“, sagte er, „Ich werde kein Geld von dir für Reisen oder Essen nehmen.“ Du wirst mein Gast auf dem Schiff sein. Wenn Sie einige Dinge mitnehmen und es schaffen, diese in Guinea sehr gewinnbringend zu verkaufen, erhalten Sie den gesamten Gewinn. Versuchen Sie Ihr Glück – vielleicht haben Sie Glück.
Da dieser Kapitän das allgemeine Vertrauen genoss, nahm ich seine Einladung gerne an.
Als ich nach Guinea ging, nahm ich einige Waren mit: Ich kaufte für vierzig Pfund Sterling verschiedene Schmuckstücke und Glasgegenstände, die sich unter den Wilden gut verkauften.
Diese vierzig Pfund erhielt ich mit der Hilfe naher Verwandter, mit denen ich in Briefwechsel stand: Ich teilte ihnen mit, dass ich Handel treiben würde, und sie überredeten meine Mutter und vielleicht auch meinen Vater, mir zumindest mit einem kleinen Betrag zu helfen in meinem ersten Unternehmen.
Diese Reise nach Afrika war sozusagen meine einzige erfolgreiche Reise. Natürlich verdankte ich meinen Erfolg ausschließlich der Selbstlosigkeit und Freundlichkeit des Kapitäns.
Während der Reise lernte er bei mir Mathematik und brachte mir Schiffbau bei. Es hat ihm Spaß gemacht, seine Erfahrungen mit mir zu teilen, und ich habe es genossen, ihm zuzuhören und von ihm zu lernen.
Die Reise machte mich sowohl zum Seemann als auch zum Kaufmann: Ich tauschte fünf Pfund und neun Unzen Goldstaub gegen meine Schmuckstücke, für die ich bei meiner Rückkehr nach London eine angemessene Summe erhielt.
Doch zu meinem Unglück starb mein Freund, der Kapitän, kurz nach meiner Rückkehr nach England, und ich musste eine zweite Reise alleine unternehmen, ohne freundlichen Rat und Hilfe.
Ich bin mit demselben Schiff von England aus gesegelt. Es war die elendste Reise, die der Mensch je unternommen hat.
Eines Tages im Morgengrauen, als wir nach einer langen Reise zwischen den Kanarischen Inseln und Afrika unterwegs waren, wurden wir von Piraten – Seeräubern – angegriffen. Das waren Türken aus Saleh. Sie bemerkten uns schon von weitem und machten sich mit vollen Segeln auf den Weg zu uns.
Wir hofften zunächst, dass wir ihnen durch die Flucht entkommen könnten, und setzten auch alle Segel. Aber es wurde schnell klar, dass sie uns in fünf oder sechs Stunden sicherlich einholen würden. Uns wurde klar, dass wir uns auf den Kampf vorbereiten mussten. Wir hatten zwölf Kanonen und der Feind hatte achtzehn.
Gegen drei Uhr nachmittags holte uns das Räuberschiff ein, doch die Piraten machten einen großen Fehler: Statt uns vom Heck zu nähern, näherten sie sich uns von der Backbordseite, wo wir acht Kanonen hatten. Wir nutzten ihren Fehler aus, richteten all diese Waffen auf sie und feuerten eine Salve ab.
Es waren mindestens zweihundert Türken, also antworteten sie auf unser Feuer nicht nur mit Kanonen, sondern auch mit einer Waffensalve von zweihundert Kanonen.
Glücklicherweise wurde niemand getroffen, alle blieben gesund und munter. Nach diesem Kampf zog sich das Piratenschiff eine halbe Meile zurück und begann, sich auf einen neuen Angriff vorzubereiten. Wir haben uns unsererseits auf eine neue Verteidigung vorbereitet.
Diesmal kamen die Feinde von der anderen Seite auf uns zu und enterten uns, das heißt, sie hingen mit Haken an unserer Seite fest; Ungefähr sechzig Leute stürmten auf das Deck und beeilten sich zunächst, die Masten und das Gerät zu zerschneiden.
Wir begegneten ihnen mit Gewehrfeuer und räumten zweimal das Deck von ihnen, mussten uns aber dennoch ergeben, da unser Schiff nicht mehr für eine weitere Reise geeignet war. Drei unserer Männer wurden getötet und acht verletzt. Wir wurden als Gefangene in die Hafenstadt Saleh gebracht, die den Mauren gehörte.
Die anderen Engländer wurden ins Landesinnere geschickt, an den Hof des grausamen Sultans, aber der Kapitän des Räuberschiffs behielt mich bei sich und machte ihn zu seinem Sklaven, weil ich jung und flink war.
Ich weinte bitterlich: Ich erinnerte mich an die Vorhersage meines Vaters, dass mir früher oder später Ärger passieren würde und mir niemand zu Hilfe kommen würde. Ich dachte, dass ich es war, der solch ein Unglück erlitten hatte. Leider hatte ich keine Ahnung, dass noch schlimmere Probleme bevorstehen.
Da mich mein neuer Herr, der Kapitän des Räuberschiffs, bei sich gelassen hatte, hoffte ich, dass er mich mitnehmen würde, wenn er erneut Seeschiffe ausrauben würde. Ich war fest davon überzeugt, dass er am Ende von einem spanischen oder portugiesischen Kriegsschiff gefangen genommen werden würde und ich dann meine Freiheit zurückerhalten würde.
Doch bald wurde mir klar, dass diese Hoffnungen vergebens waren, denn als mein Herr zum ersten Mal zur See fuhr, ließ er mich zu Hause, um die niedere Arbeit zu erledigen, die Sklaven normalerweise verrichten.
Von diesem Tag an dachte ich nur noch an Flucht. Aber es war unmöglich zu entkommen: Ich war allein und machtlos. Unter den Gefangenen gab es keinen einzigen Engländer, dem ich vertrauen konnte. Ich schmachtete zwei Jahre lang in Gefangenschaft, ohne die geringste Hoffnung auf Flucht. Aber im dritten Jahr gelang mir trotzdem die Flucht. Es ist so passiert. Mein Herr fuhr ständig, ein- oder zweimal in der Woche, mit einem Schiff an die Küste, um zu fischen. Auf jeder dieser Reisen nahm er mich und einen Jungen mit, der Xuri hieß. Wir ruderten fleißig und unterhielten unseren Meister, so gut wir konnten. Und da ich mich außerdem als guter Fischer erwies, schickte er uns beide – mich und diesen Xuri – manchmal zum Fischen unter der Aufsicht eines alten Mauren, seines entfernten Verwandten.
Eines Tages lud mein Herr zwei sehr bedeutende Mauren ein, mit ihm auf seinem Segelboot zu fahren. Für diese Reise bereitete er große Vorräte an Lebensmitteln vor, die er abends auf sein Boot schickte. Das Boot war geräumig. Der Eigner befahl vor zwei Jahren seinem Schiffsschreiner, darin eine kleine Kabine und in der Kabine eine Speisekammer für Proviant zu bauen. Ich habe alle meine Vorräte in dieser Speisekammer untergebracht.
„Vielleicht wollen die Gäste jagen“, sagte mir der Besitzer. - Nehmen Sie drei Kanonen vom Schiff und bringen Sie sie zum Boot.
Ich tat alles, was mir befohlen wurde: Ich wusch das Deck, hisste die Flagge am Mast und saß am nächsten Morgen im Boot und wartete auf Gäste. Plötzlich kam der Besitzer allein und sagte, dass seine Gäste heute nicht gehen würden, da sie sich aus geschäftlichen Gründen verspäteten. Dann befahl er uns dreien – mir, dem Jungen Xuri und dem Mauren –, mit unserem Boot zum Meeresufer zu fahren, um dort Fische zu fangen.
„Meine Freunde werden mit mir zum Abendessen kommen“, sagte er, „Sobald Sie also genug Fisch gefangen haben, bringen Sie ihn hierher.“
Da erwachte in mir wieder der alte Traum von der Freiheit. Jetzt hatte ich ein Schiff, und sobald der Besitzer weg war, begann ich mit den Vorbereitungen – nicht für den Fischfang, sondern für eine lange Reise. Ich wusste zwar nicht, wohin ich meinen Weg führen sollte, aber jeder Weg ist gut – solange er die Flucht aus der Gefangenschaft bedeutet.
„Wir sollten uns etwas zu essen besorgen“, sagte ich zum Mauren. „Wir können das Essen, das der Besitzer für die Gäste zubereitet hat, nicht ungefragt essen.“
Der alte Mann stimmte mir zu und brachte bald einen großen Korb mit Semmelbröseln und drei Krüge mit frischem Wasser.
Ich wusste, wo der Besitzer eine Kiste Wein hatte, und während der Maure Proviant holte, transportierte ich alle Flaschen zum Boot und stellte sie in die Speisekammer, als ob sie zuvor für den Besitzer gelagert worden wären.
Außerdem brachte ich ein riesiges Stück Wachs mit (fünfzig Pfund schwer) und schnappte mir einen Knäuel Garn, eine Axt, eine Säge und einen Hammer. All dies war später für uns sehr nützlich, insbesondere das Wachs, aus dem wir Kerzen hergestellt haben.
Ich habe mir einen weiteren Trick ausgedacht und wieder gelang es mir, den einfältigen Mauren zu täuschen. Sein Name war Ismael, deshalb nannten ihn alle Moli. Also sagte ich ihm:
- Beten Sie, auf dem Schiff sind die Jagdgewehre des Besitzers. Es wäre schön, etwas Schießpulver und ein paar Ladungen zu besorgen – vielleicht haben wir das Glück, zum Abendessen ein paar Watvögel zu erschießen. Ich weiß, dass der Besitzer Schießpulver und Schüsse auf dem Schiff aufbewahrt.
„Okay“, sagte er, „ich bringe es.“
Und er brachte eine große Ledertasche mit Schießpulver – eineinhalb Pfund schwer, vielleicht auch mehr – und eine weitere mit Schrot – fünf oder sechs Pfund. Er nahm auch die Kugeln ab. All dies wurde im Boot aufbewahrt. Außerdem befand sich in der Kapitänskajüte noch etwas Schießpulver, das ich in eine große Flasche füllte, nachdem ich zuvor den restlichen Wein daraus ausgegossen hatte.
Nachdem wir uns mit allem Notwendigen für eine lange Reise eingedeckt hatten, verließen wir den Hafen wie zum Angeln. Ich habe meine Angelruten ins Wasser gesteckt, aber nichts gefangen (ich habe meine Angelruten absichtlich nicht herausgezogen, als der Fisch am Haken war).
„Wir werden hier nichts fangen!“ - Ich sagte zum Mauren. „Der Besitzer wird uns nicht loben, wenn wir mit leeren Händen zu ihm zurückkehren.“ Wir müssen weiter aufs Meer hinaus vordringen. Vielleicht beißt der Fisch abseits des Ufers besser zu.
Der alte Maure ahnte keine Täuschung, stimmte mir zu und hob, da er am Bug stand, das Segel.
Ich saß am Steuer, am Heck, und als sich das Schiff drei Meilen aufs offene Meer hinausbewegte, begann ich zu treiben – als wollte ich wieder mit dem Angeln beginnen. Dann übergab ich dem Jungen das Steuerrad, stieg auf den Bug, näherte mich dem Mauren von hinten, hob ihn plötzlich hoch und warf ihn ins Meer. Er tauchte sofort wieder auf, denn er schwebte wie ein Korken, und rief mir zu, ich solle ihn ins Boot nehmen, und versprach, dass er mit mir bis ans Ende der Welt fahren würde. Er schwamm so schnell hinter dem Schiff her, dass er mich sehr bald eingeholt hätte (der Wind war schwach und das Boot bewegte sich kaum). Da ich sah, dass der Maure uns bald überholen würde, rannte ich zur Hütte, nahm eines der Jagdgewehre dort, zielte auf den Mauren und sagte:
„Ich wünsche dir nichts Böses, aber lass mich jetzt in Ruhe und komm schnell nach Hause!“ Du bist ein guter Schwimmer, das Meer ist ruhig, du kannst problemlos bis zum Ufer schwimmen. Dreh dich um und ich werde dich nicht berühren. Aber wenn du das Boot nicht verlässt, schieße ich dir in den Kopf, weil ich entschlossen bin, meine Freiheit zu gewinnen.
Er wandte sich dem Ufer zu und schwamm sicher ohne Schwierigkeiten dorthin.
Natürlich könnte ich diesen Mauren mitnehmen, aber auf den alten Mann war kein Verlass.
Als der Mohr hinter das Boot fiel, drehte ich mich zu dem Jungen um und sagte:
- Xuri, wenn du mir treu bist, werde ich dir viel Gutes tun. Schwöre, dass du mich niemals betrügen wirst, sonst werde ich dich auch ins Meer werfen. Der Junge lächelte, sah mir direkt in die Augen und schwor, dass er mir bis zum Grab treu bleiben und mit mir gehen würde, wohin ich wollte. Er sprach so aufrichtig, dass ich nicht anders konnte, als ihm zu glauben.
Bis sich das Moor dem Ufer näherte, steuerte ich gegen den Wind auf das offene Meer zu, damit alle dachten, wir würden nach Gibraltar fahren.
Doch sobald es anfing zu dämmern, begann ich nach Süden zu steuern und hielt mich dabei leicht nach Osten, weil ich mich nicht von der Küste entfernen wollte. Es wehte ein sehr frischer Wind, aber das Meer war flach und ruhig, und deshalb kamen wir in gutem Tempo voran.
Als am nächsten Tag um drei Uhr zum ersten Mal Land vor uns auftauchte, befanden wir uns bereits eineinhalbhundert Meilen südlich von Saleh, weit jenseits der Grenzen der Besitztümer des marokkanischen Sultans und überhaupt aller anderen Afrikanischer König. Das Ufer, dem wir uns näherten, war völlig menschenleer. Aber in der Gefangenschaft bekam ich solche Angst und hatte solche Angst, wieder von den Mauren gefangen genommen zu werden, dass ich den günstigen Wind ausnutzte, der mein Boot nach Süden trieb, und fünf Tage lang immer weiter segelte, ohne zu ankern oder an Land zu gehen.
Fünf Tage später änderte sich der Wind: Er wehte aus Süden, und da ich keine Angst mehr vor einer Verfolgung hatte, beschloss ich, mich dem Ufer zu nähern und an der Mündung eines kleinen Flusses vor Anker zu gehen. Ich kann nicht sagen, um was für einen Fluss es sich handelt, wo er fließt und was für Menschen an seinen Ufern leben. Seine Ufer waren verlassen, und das freute mich sehr, da ich keine Lust hatte, Menschen zu sehen. Das Einzige, was ich brauchte, war frisches Wasser.
Wir betraten die Mündung am Abend und beschlossen, als es dunkel wurde, an Land zu schwimmen und die gesamte Umgebung zu untersuchen. Doch sobald es dunkel wurde, hörten wir schreckliche Geräusche vom Ufer: Am Ufer wimmelte es von Tieren, die so wütend heulten, knurrten, brüllten und bellten, dass der arme Xuri vor Angst fast starb und mich anflehte, bis dahin nicht an Land zu gehen Morgen.
„Okay, Xuri“, sagte ich zu ihm, „lass uns warten!“ Aber vielleicht werden wir bei Tageslicht Menschen sehen, unter denen wir vielleicht noch schlimmer leiden werden als unter den wilden Tigern und Löwen.
„Und wir werden diese Leute mit einer Waffe erschießen“, sagte er lachend, „und sie werden weglaufen!“
Ich war froh, dass sich der Junge gut benahm. Damit er in Zukunft nicht entmutigt wird, schenkte ich ihm einen Schluck Wein.
Ich befolgte seinen Rat und wir blieben die ganze Nacht vor Anker, ohne das Boot zu verlassen und unsere Waffen bereitzuhalten. Wir mussten bis zum Morgen kein Auge zudrücken.
Zwei oder drei Stunden nachdem wir vor Anker gegangen waren, hörten wir das schreckliche Brüllen einiger riesiger Tiere einer sehr seltsamen Rasse (wir wussten selbst nicht, was). Die Tiere näherten sich dem Ufer, betraten den Fluss, begannen darin zu planschen und sich zu suhlen, offensichtlich wollten sie sich erfrischen, und gleichzeitig kreischten, brüllten und heulten sie; So widerliche Geräusche hatte ich noch nie zuvor gehört.
Xuri zitterte vor Angst; Ehrlich gesagt hatte ich auch Angst.
Aber wir hatten beide noch mehr Angst, als wir hörten, dass eines der Monster auf unser Schiff zuschwamm. Wir konnten es nicht sehen, aber wir hörten es nur schnaufen und schnauben, und allein anhand dieser Geräusche schlossen wir, dass das Monster riesig und wild war.
„Es muss ein Löwe sein“, sagte Xuri. - Lasst uns den Anker lichten und hier verschwinden!
„Nein, Xuri“, wandte ich ein, „wir haben keinen Grund, den Anker zu lichten.“ Wir lassen das Seil einfach länger laufen und bewegen uns weiter hinaus ins Meer – die Tiere werden uns nicht verfolgen.
Doch sobald ich diese Worte aussprach, sah ich ein unbekanntes Tier in einer Entfernung von zwei Rudern von unserem Schiff. Ich war etwas verwirrt, aber ich nahm sofort eine Waffe aus der Kabine und feuerte. Das Tier drehte sich um und schwamm zum Ufer.

Es ist unmöglich zu beschreiben, was für ein wütendes Brüllen am Ufer entstand, als mein Schuss fiel: Die Tiere hier dürften dieses Geräusch noch nie zuvor gehört haben. Hier war ich schließlich davon überzeugt, dass es unmöglich war, nachts an Land zu gehen. Aber ob es überhaupt möglich wäre, tagsüber zu landen – auch das wussten wir nicht. Opfer eines Wilden zu werden ist nicht besser, als in die Klauen eines Löwen oder Tigers zu fallen.
Aber wir mussten unbedingt hier oder anderswo an Land gehen, da wir keinen Tropfen Wasser mehr hatten. Wir waren schon lange durstig. Endlich kam der lang erwartete Morgen. Xuri sagte, wenn ich ihn gehen ließe, würde er zum Ufer waten und versuchen, frisches Wasser zu bekommen. Und als ich ihn fragte, warum er gehen sollte und nicht ich, antwortete er:
„Wenn ein wilder Mann kommt, wird er mich fressen und du wirst am Leben bleiben.“
Diese Antwort drückte eine solche Liebe zu mir aus, dass ich tief berührt war.
„Das ist es, Xuri“, sagte ich, „wir gehen beide.“ Und wenn ein wilder Mann kommt, werden wir ihn erschießen, und er wird weder dich noch mich fressen.
Ich gab dem Jungen ein paar Cracker und einen Schluck Wein; Dann zogen wir uns näher an den Boden heran, sprangen ins Wasser und wateten zum Ufer, wobei wir nichts als Waffen und zwei leere Wasserkrüge mitnahmen.
Ich wollte mich nicht vom Ufer entfernen, um unser Schiff nicht aus den Augen zu verlieren.
Ich hatte Angst, dass Wilde in ihren Pirogen den Fluss hinunter zu uns kommen könnten. Aber Ksuri, der eine Meile vom Ufer entfernt eine Mulde bemerkte, stürzte mit dem Krug dorthin.
Plötzlich sehe ich ihn zurücklaufen. „Haben die Wilden ihn verfolgt? – Dachte ich voller Angst. „Hatte er Angst vor einem Raubtier?“
Ich eilte ihm zu Hilfe und als ich näher rannte, sah ich, dass etwas Großes hinter seinem Rücken hing. Es stellte sich heraus, dass er ein Tier wie unseren Hasen getötet hatte, nur dass sein Fell eine andere Farbe hatte und seine Beine länger waren. Wir waren beide froh über dieses Spiel, aber ich freute mich noch mehr, als Xury mir erzählte, dass er in der Mulde viel gutes Süßwasser gefunden hatte.
Nachdem wir die Krüge gefüllt hatten, frühstückten wir ausgiebig mit dem getöteten Tier und machten uns auf den Weg zu unserer weiteren Reise. Wir haben also in diesem Bereich keine Spuren von Menschen gefunden.
Nachdem wir die Flussmündung verlassen hatten, musste ich während unserer weiteren Reise mehrmals am Ufer anlegen, um frisches Wasser zu holen.
Eines frühen Morgens gingen wir an einem hohen Kap vor Anker. Die Flut hat bereits begonnen. Plötzlich flüsterte Xuri, dessen Augen offenbar schärfer waren als meine:
Ich schaute in die Richtung, in die Xuri zeigte, und sah wirklich ein schreckliches Biest. Es war ein riesiger Löwe. Er lag unter dem Felsvorsprung.
„Hör zu, Xuri“, sagte ich, „geh ans Ufer und töte diesen Löwen.“ Der Junge hatte Angst.
- Ich sollte ihn töten! - er rief aus. - Aber der Löwe wird mich wie eine Fliege verschlingen!
Ich bat ihn, sich nicht zu bewegen, und holte, ohne ein weiteres Wort mit ihm zu sagen, alle unsere Waffen (es waren drei) aus der Hütte. Ich lud einen, den größten und schwerfälligsten, mit zwei Bleistücken, nachdem ich zuvor eine gute Ladung Schießpulver in den Lauf gegossen hatte; Er rollte zwei große Kugeln in eine andere und fünf kleinere Kugeln in die dritte.
Ich nahm die erste Waffe, zielte sorgfältig und schoss auf das Biest. Ich zielte auf seinen Kopf, aber er lag in einer solchen Position (die Pfote bedeckte seinen Kopf auf Augenhöhe), dass die Ladung seine Pfote traf und den Knochen zerschmetterte. Lez knurrte und sprang auf, aber als er Schmerzen verspürte, fiel er, stand dann auf drei Beinen auf und humpelte vom Ufer weg, wobei er ein so verzweifeltes Brüllen ausstieß, das ich noch nie zuvor gehört hatte.
Es war mir ein wenig peinlich, dass ich seinen Kopf verpasst hatte; Doch ohne eine Minute zu zögern, nahm er die zweite Waffe und schoss hinter dem Biest her. Dieses Mal traf mein Angriff das Ziel. Der Löwe fiel und machte kaum hörbare heisere Geräusche.
Als Xuri das verwundete Tier sah, verschwanden alle seine Ängste und er begann mich zu bitten, ihn an Land gehen zu lassen.
- Alles klar los! - Ich sagte.
Der Junge sprang ins Wasser und schwamm zum Ufer, wobei er mit einer Hand arbeitete, weil er in der anderen eine Waffe hatte. Er näherte sich dem gefallenen Tier, hielt ihm die Mündung einer Waffe ans Ohr und tötete es sofort.
Es war natürlich schön, auf der Jagd einen Löwen zu erschießen, aber sein Fleisch war nicht zum Essen geeignet, und es tat mir sehr leid, dass wir drei Ladungen für so wertloses Wild ausgegeben haben. Xuri sagte jedoch, dass er versuchen würde, aus dem getöteten Löwen Profit zu schlagen, und als wir zum Boot zurückkehrten, bat er mich um eine Axt.
- Wofür? - Ich fragte.
„Schneiden Sie ihm den Kopf ab“, antwortete er.

Allerdings konnte er den Kopf nicht abschlagen, da ihm die Kraft fehlte: Er schnitt nur eine Pfote ab, die er zu unserem Boot brachte. Die Pfote hatte eine ungewöhnliche Größe.
Dann kam mir der Gedanke, dass die Haut dieses Löwen vielleicht für uns nützlich sein könnte, und ich beschloss, zu versuchen, ihn zu häuten. Wir gingen wieder an Land, aber ich wusste nicht, wie ich diesen Job annehmen sollte. Es stellte sich heraus, dass Xuri geschickter war als ich.
Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Die Haut wurde erst abends entfernt. Wir haben es auf dem Dach unserer kleinen Hütte ausgebreitet. Zwei Tage später trocknete es in der Sonne vollständig aus und diente mir dann als Bett.
Nachdem wir von diesem Ufer aus die Segel gesetzt hatten, segelten wir direkt nach Süden und änderten zehn oder zwölf Tage hintereinander unsere Richtung nicht.
Da unsere Vorräte zur Neige gingen, versuchten wir, so sparsam wie möglich mit unseren Vorräten umzugehen. Wir gingen nur an Land, um frisches Wasser zu holen.
Ich wollte zur Mündung des Flusses Gambia oder Senegal, also zu den an die Kapverden angrenzenden Orten, gelangen, da ich hoffte, hier ein europäisches Schiff zu treffen. Ich wusste, wenn ich an diesen Orten kein Schiff treffen würde, müsste ich mich entweder auf das offene Meer auf die Suche nach Inseln begeben oder unter den Schwarzen sterben – ich hatte keine andere Wahl.
Ich wusste auch, dass alle Schiffe, die von Europa aus fahren, wohin auch immer sie gehen – an die Küste Guineas, nach Brasilien oder nach Ostindien –, an den Kapverden vorbeifahren, und deshalb schien es mir, dass mein ganzes Glück nur davon abhing, ob ich wird jedes europäische Schiff in Kap Verde treffen.
„Wenn ich dich nicht treffe“, sagte ich mir, „drohe mir der sichere Tod.“
Treffen mit den Wilden
Weitere zehn Tage vergingen. Wir bewegten uns stetig weiter nach Süden. Zunächst war die Küste menschenleer; Dann sahen wir an zwei oder drei Stellen nackte Schwarze, die am Ufer standen und uns ansahen.
Ich beschloss irgendwie, an Land zu gehen und mit ihnen zu reden, aber Xuri, mein weiser Berater, sagte:
- Geh nicht! Geh nicht! Nicht nötig!
Und doch begann ich, näher am Ufer zu bleiben, um mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Wilden verstanden offensichtlich, was ich wollte, und rannten uns lange Zeit am Ufer entlang hinterher.
Mir fiel auf, dass sie unbewaffnet waren, nur einer von ihnen hatte einen langen, dünnen Stock in der Hand. Xuri erzählte mir, dass es ein Speer sei und dass die Wilden ihre Speere sehr weit und mit erstaunlicher Genauigkeit werfen. Also hielt ich etwas Abstand zu ihnen und sprach sie durch Zeichen an, um ihnen klarzumachen, dass wir hungrig waren und Essen brauchten. Sie verstanden es und begannen ihrerseits, mir Zeichen zu geben, mein Boot anzuhalten, da sie uns Essen bringen wollten.
Ich ließ das Segel ein und das Boot blieb stehen. Zwei Wilde rannten irgendwohin und eine halbe Stunde später brachten sie zwei große Stücke Trockenfleisch und zwei Säcke Getreide von einer dort wachsenden Getreidesorte. Wir wussten nicht, um welche Art von Fleisch oder Getreide es sich handelte, äußerten aber unsere volle Bereitschaft, beides zu akzeptieren.
Aber wie erhält man das angebotene Geschenk? Wir konnten nicht an Land gehen: Wir hatten Angst vor den Wilden, und sie hatten Angst vor uns. Und damit sich beide Seiten sicher fühlten, häuften die Wilden alle Vorräte am Ufer auf und zogen weg. Erst nachdem wir sie zum Boot transportiert hatten, kehrten sie an ihren ursprünglichen Platz zurück.
Die Freundlichkeit der Wilden berührte uns, wir dankten ihnen mit Zeichen, da wir ihnen keine Gegengeschenke anbieten konnten.
Doch genau in diesem Moment hatten wir die wunderbare Gelegenheit, ihnen einen großen Dienst zu erweisen.
Bevor wir die Küste verlassen konnten, sahen wir plötzlich zwei starke und schreckliche Tiere hinter den Bergen hervorrennen. Sie stürmten so schnell sie konnten direkt zum Meer. Es kam uns so vor, als würde einer von ihnen den anderen verfolgen. Die Menschen am Ufer, insbesondere die Frauen, hatten schreckliche Angst. Es begann ein Tumult, viele schrien und weinten. Nur der Wilde, der den Speer hatte, blieb an Ort und Stelle, alle anderen begannen in alle Richtungen zu rennen. Aber die Tiere stürzten direkt ins Meer und berührten keines der Schwarzen. Erst da sah ich, wie riesig sie waren. Sie rannten ins Wasser und begannen zu tauchen und zu schwimmen, so dass man vielleicht meinen könnte, sie seien nur zum Schwimmen im Meer hierher gekommen.
Plötzlich schwamm einer von ihnen ganz nah an unserem Boot vorbei. Damit hatte ich nicht gerechnet, war aber trotzdem nicht überrascht: Nachdem ich schnell die Waffe geladen hatte, bereitete ich mich auf den Angriff auf den Feind vor. Sobald er sich uns auf Gewehrschussweite näherte, drückte ich den Abzug und schoss ihm in den Kopf. Im selben Moment stürzte er sich ins Wasser, tauchte dann wieder auf und schwamm zurück zum Ufer, verschwand dann im Wasser und tauchte dann wieder an der Oberfläche auf. Er kämpfte mit dem Tod, Erstickungsgefahr und Blutungen. Bevor er das Ufer erreichte, starb er und sank.
Keine Worte können beschreiben, wie fassungslos die Wilden waren, als sie das Brüllen hörten und das Feuer meines Schusses sahen: Andere starben fast vor ihrer Angst und fielen wie tot zu Boden.
Aber als sie sahen, dass das Tier getötet wurde und ich ihnen Zeichen gab, näher an das Ufer zu kommen, wurden sie mutiger und drängten sich in der Nähe des Wassers selbst: Offenbar wollten sie das getötete Tier unbedingt unter Wasser finden. An der Stelle, an der er ertrank, war das Wasser voller Blut, und deshalb konnte ich ihn leicht finden. Nachdem ich es mit einem Seil befestigt hatte, warf ich sein Ende den Wilden zu und sie zogen das tote Tier ans Ufer. Es war ein großer Leopard mit einer ungewöhnlich schönen gefleckten Haut. Die Wilden, die über ihm standen, hoben voller Erstaunen und Freude die Hände; Sie konnten nicht verstehen, was ich benutzte, um ihn zu töten.
Ein anderes Tier, erschreckt von meinem Schuss, schwamm ans Ufer und stürzte zurück in die Berge.
Mir fiel auf, dass die Wilden unbedingt das Fleisch eines getöteten Leoparden essen wollten, und mir kam der Gedanke, dass es gut wäre, wenn sie es von mir als Geschenk bekämen.
Ich habe ihnen durch Zeichen gezeigt, dass sie das Biest für sich behalten könnten.
Sie dankten mir herzlich und machten sich sofort an die Arbeit. Sie hatten keine Messer, aber mit einem scharfen Holzstück entfernten sie die Haut des toten Tieres so schnell und geschickt, wie wir sie mit einem Messer nicht hätten entfernen können.
Sie boten mir Fleisch an, aber ich lehnte ab und machte ein Zeichen, dass ich es ihnen geben würde. Ich bat sie um die Haut, die sie mir sehr gerne gaben. Außerdem brachten sie mir einen neuen Vorrat an Proviant und ich nahm ihr Geschenk gerne an. Dann bat ich sie um Wasser: Ich nahm einen unserer Krüge und drehte ihn um, um zu zeigen, dass er leer war, und bat darum, ihn zu füllen. Dann riefen sie etwas. Wenig später erschienen zwei Frauen und brachten ein großes Gefäß aus gebranntem Ton (Wilde müssen Ton in der Sonne backen). Die Frauen stellten dieses Schiff ans Ufer und gingen wie zuvor selbst davon. Ich schickte Xuri mit allen drei Krügen an Land und er füllte sie bis zum Rand.
Nachdem ich so Wasser, Fleisch und Getreide erhalten hatte, trennte ich mich von den freundlichen Wilden und setzte meine Reise elf Tage lang in derselben Richtung fort, ohne mich dem Ufer zuzuwenden.
Während der Ruhe machten wir jede Nacht ein Feuer und zündeten eine selbstgemachte Kerze in der Laterne an, in der Hoffnung, dass irgendein Schiff unsere winzige Flamme bemerken würde, aber unterwegs traf uns kein einziges Schiff.
Schließlich sah ich etwa fünfzehn Meilen vor mir einen Landstreifen, der weit ins Meer hineinragte. Das Wetter war ruhig und ich bog ins offene Meer ein, um diese Landzunge zu umrunden. In diesem Moment, als wir die Spitze erreichten, sah ich deutlich ein weiteres Land etwa sechs Meilen von der Küste entfernt auf der Meerseite und kam zu dem völlig richtigen Schluss, dass es sich bei der schmalen Landzunge um Kap Verde handelte und dass das Land, das in der Ferne aufragte, eines davon war die Kapverdischen Inseln. Aber die Inseln waren sehr weit weg und ich traute mich nicht, dorthin zu gehen.
Plötzlich hörte ich einen Jungen schreien:
- Meister! Herr! Schiff und segel!
Der naive Xuri war so verängstigt, dass er fast den Verstand verlor: Er stellte sich vor, dass es sich um eines der Schiffe seines Herrn handelte, das uns verfolgen sollte. Aber ich wusste, wie weit wir uns von den Mauren entfernt hatten, und ich war sicher, dass sie keine Angst mehr vor uns hatten.
Ich sprang aus der Kabine und sah sofort das Schiff. Ich konnte sogar erkennen, dass es sich um ein portugiesisches Schiff handelte. „Er muss auf die Küste Guineas zusteuern“, dachte ich. Doch als ich genauer hinsah, war ich überzeugt, dass das Schiff in eine andere Richtung fuhr und nicht die Absicht hatte, sich dem Ufer zuzuwenden. Dann hisste ich alle Segel und stürmte aufs offene Meer, wobei ich beschloss, um jeden Preis Verhandlungen mit dem Schiff aufzunehmen.
Mir wurde schnell klar, dass ich selbst bei voller Fahrt keine Zeit haben würde, nahe genug heranzukommen, damit das Schiff meine Signale erkennen konnte. Doch gerade in dem Moment, als ich zu verzweifeln begann, wurden wir vom Deck aus gesehen – wahrscheinlich durch ein Fernglas. Wie ich später erfuhr, entschied das Schiff, dass es sich um das Boot eines gesunkenen europäischen Schiffes handelte. Das Schiff driftete, um mir Gelegenheit zu geben, näher zu kommen, und ich machte etwa drei Stunden später daran fest.
Sie fragten mich, wer ich sei, zuerst auf Portugiesisch, dann auf Spanisch, dann auf Französisch, aber ich beherrschte keine dieser Sprachen.
Schließlich sprach mich ein Seemann, ein Schotte, auf Englisch an und ich erzählte ihm, dass ich ein Engländer sei, der aus der Gefangenschaft geflohen sei. Dann wurden meine Begleiterin und ich sehr freundlich auf das Schiff eingeladen. Bald befanden wir uns mit unserem Boot an Deck.
Es ist unmöglich, die Freude, die ich empfand, als ich mich frei fühlte, in Worte zu fassen. Ich wurde sowohl vor der Sklaverei als auch vor dem Tod gerettet, der mich bedrohte! Mein Glück war grenzenlos. Um dies zu feiern, schenkte ich meinem Retter, dem Kapitän, als Belohnung für meine Befreiung den gesamten Besitz, der bei mir war. Doch der Kapitän lehnte ab.
„Ich werde dir nichts wegnehmen“, sagte er. – Alle Ihre Sachen werden Ihnen unversehrt zurückgegeben, sobald wir in Brasilien ankommen. Ich habe Ihr Leben gerettet, weil ich mir bewusst bin, dass ich selbst in die gleichen Schwierigkeiten hätte geraten können. Und wie glücklich wäre ich dann, wenn Sie mir die gleiche Hilfe zukommen lassen würden! Vergessen Sie auch nicht, dass wir nach Brasilien fahren, und Brasilien ist weit von England entfernt, und dort kann man ohne diese Dinge verhungern. Ich habe dich nicht gerettet, nur um dich später zu zerstören! Nein, nein, mein Herr, ich bringe Sie kostenlos nach Brasilien und die Dinge geben Ihnen die Möglichkeit, sich mit Essen zu versorgen und die Reise in Ihr Heimatland zu bezahlen.
Robinson lässt sich in Brasilien nieder. - Er geht wieder zur See. - Sein Schiff ist zerstört
Der Kapitän war nicht nur in seinen Worten, sondern auch in seinen Taten großmütig und großzügig. Er hat alle seine Versprechen treu erfüllt. Er befahl, dass keiner der Matrosen es wagen dürfe, mein Eigentum zu berühren, dann erstellte er eine detaillierte Liste aller mir gehörenden Sachen, befahl, sie mit seinen Sachen zusammenzulegen, und überreichte mir die Liste, damit ich bei meiner Ankunft in Brasilien konnte alles vollständig erhalten.
Er wollte mein Boot kaufen. Das Boot war wirklich gut. Der Kapitän sagte, er würde es für sein Schiff kaufen und fragte, wie viel ich dafür wollte.
„Sie“, antwortete ich, „haben mir so viel Gutes getan, dass ich mich in keiner Weise für berechtigt halte, einen Preis für das Boot festzulegen.“ Ich werde so viel nehmen, wie du gibst.
Dann sagte er, dass er mir eine schriftliche Verpflichtung geben würde, sofort nach Ankunft in Brasilien achtzig Dukaten für mein Boot zu zahlen, aber wenn es dort einen anderen Käufer für mich gäbe, der mir mehr bieten würde, würde mir der Kapitän den gleichen Betrag zahlen.
Unser Umzug nach Brasilien verlief recht sicher. Unterwegs halfen wir den Matrosen und sie freundeten sich mit uns an. Nach einer zweiundzwanzigtägigen Reise erreichten wir die Allerheiligenbucht. Dann hatte ich endlich das Gefühl, dass meine Probleme hinter mir lagen, dass ich bereits ein freier Mann und kein Sklave war und dass mein Leben von vorne beginnen würde.
Ich werde nie vergessen, wie großzügig der Kapitän des portugiesischen Schiffes mich behandelt hat.
Er hat mir für den Fahrpreis keinen Cent berechnet; er gab mir alle meine Sachen völlig unversehrt zurück, bis auf drei Tonkrüge; Er gab mir vierzig Goldstücke für ein Löwenfell und zwanzig für ein Leopardenfell und kaufte im Allgemeinen alles, was ich im Überschuss hatte und was ich bequem verkaufen konnte, einschließlich einer Kiste Wein, zwei Gewehren und dem restlichen Wachs (ein Teil davon). die wir für Kerzen verwendet haben). Mit einem Wort, als ich ihm den größten Teil meines Eigentums verkaufte und an der Küste Brasiliens landete, hatte ich zweihundertzwanzig Goldstücke in meiner Tasche.
Ich wollte mich nicht von meinem Begleiter Xuri trennen: Er war ein so treuer und zuverlässiger Kamerad, er half mir, die Freiheit zu erlangen. Aber er hatte nichts mit mir zu tun; außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich ihn ernähren könnte. Daher freute ich mich sehr, als mir der Kapitän sagte, dass er diesen Jungen mochte, dass er ihn bereitwillig an Bord seines Schiffes nehmen und ihn zum Seemann machen würde.
Kurz nach meiner Ankunft in Brasilien nahm mich mein Freund, der Kapitän, in das Haus eines seiner Bekannten mit. Er war Besitzer einer Zuckerrohrplantage und einer Zuckerfabrik. Ich habe ziemlich lange mit ihm zusammengelebt und konnte dadurch die Zuckerproduktion studieren.
Als ich sah, wie gut es den örtlichen Pflanzern ging und wie schnell sie reich wurden, beschloss ich, mich in Brasilien niederzulassen und dort auch mit der Zuckerproduktion zu beginnen. Mit all meinem Geld mietete ich ein Grundstück und begann, Pläne für meine zukünftige Plantage und mein zukünftiges Anwesen zu entwerfen.
Ich hatte einen Nachbarn auf der Plantage, der aus Lissabon hierher kam. Sein Name war Wells. Er war ursprünglich Engländer, hatte aber längst die portugiesische Staatsbürgerschaft angenommen. Er und ich kamen schnell miteinander aus und pflegten ein äußerst freundschaftliches Verhältnis. In den ersten zwei Jahren konnten wir beide kaum von unserer Ernte überleben. Aber als das Land erschlossen wurde, wurden wir reicher.
Nachdem ich vier Jahre in Brasilien gelebt und mein Geschäft schrittweise erweitert habe, ist es selbstverständlich, dass ich nicht nur Spanisch lernte, sondern auch alle meine Nachbarn sowie Kaufleute aus San Salvador, der nächstgelegenen Küstenstadt zu uns, kennenlernte. Viele von ihnen wurden meine Freunde. Wir trafen uns oft, und natürlich erzählte ich ihnen oft von meinen beiden Reisen an die Küste Guineas, wie dort Handel mit den Schwarzen betrieben wurde und wie leicht es dort an manchen Schmuck zu kommen war – an Perlen, Messer, Scheren, Äxte usw Spiegel – Goldstaub und Elfenbein kaufen.
Sie hörten mir immer mit großem Interesse zu und besprachen lange, was ich ihnen erzählte.
Eines Tages kamen drei von ihnen zu mir und nachdem sie mir versprochen hatten, dass unser gesamtes Gespräch geheim bleiben würde, sagten sie:
– Sie sagen, dass Sie dort, wo Sie waren, leicht ganze Haufen Goldstaub und andere Wertsachen bekommen könnten. Wir wollen für Gold ein Schiff nach Guinea ausrüsten. Sind Sie bereit, nach Guinea zu reisen? Sie müssen in dieses Unternehmen keinen Cent investieren: Wir geben Ihnen alles, was Sie für den Umtausch benötigen. Für Ihre Arbeit erhalten Sie, wie jeder von uns, Ihren Anteil am Gewinn.
Ich hätte mich weigern und lange im fruchtbaren Brasilien bleiben sollen, aber ich wiederhole, ich war immer der Urheber meines eigenen Unglücks. Ich wollte unbedingt neue Abenteuer auf See erleben und mein Kopf drehte sich vor Freude.
In meiner Jugend konnte ich meine Reiselust nicht überwinden und hörte nicht auf die guten Ratschläge meines Vaters. Nun konnte ich dem verlockenden Angebot meiner brasilianischen Freunde nicht widerstehen.
Ich antwortete ihnen, dass ich gerne nach Guinea reisen würde, allerdings unter der Bedingung, dass sie während meiner Reise auf meine Besitztümer aufpassen und sie nach meinen Anweisungen entsorgen würden, falls ich nicht zurückkehre.
Sie versprachen feierlich, meine Wünsche zu erfüllen und besiegelten unsere Vereinbarung mit einer schriftlichen Zusage. Ich für meinen Teil habe ein Testament für den Todesfall erstellt: Ich habe mein gesamtes bewegliches und unbewegliches Vermögen dem portugiesischen Kapitän vermacht, der mir das Leben gerettet hat. Aber gleichzeitig machte ich einen Vorbehalt, dass er einen Teil der Hauptstadt nach England zu meinen betagten Eltern schicken würde.
Das Schiff war ausgerüstet und meine Begleiter beluden es vereinbarungsgemäß mit Waren.
Und hier ist es wieder – zu einer unfreundlichen Stunde! – Am 1. September 1659 betrat ich das Deck eines Schiffes. Dies war derselbe Tag, an dem ich vor acht Jahren vom Haus meines Vaters weglief und meine Jugend so wahnsinnig ruinierte.
Am zwölften Tag unserer Reise überquerten wir den Äquator und befanden uns auf sieben Grad und zweiundzwanzig Minuten nördlicher Breite, als wir plötzlich von einem heftigen Sturm erfasst wurden. Er kam aus Südosten, begann dann in die entgegengesetzte Richtung zu wehen und wehte schließlich aus Nordosten – er wehte ununterbrochen mit solch erschreckender Kraft, dass wir uns zwölf Tage lang der Macht des Hurrikans ergeben und dorthin schwimmen mussten, wohin die Wellen uns trieben . Unnötig zu erwähnen, dass ich all diese zwölf Tage jede Minute mit dem Tod gerechnet habe und keiner von uns gedacht hat, dass wir überleben würden.
Eines frühen Morgens (der Wind wehte immer noch mit der gleichen Stärke) rief einer der Matrosen:
Doch bevor wir Zeit hatten, aus den Kabinen zu rennen, um herauszufinden, an welchen Ufern unser unglückliches Schiff vorbeiraste, hatten wir das Gefühl, dass es auf Grund gelaufen war. Im selben Moment, nach dem plötzlichen Stopp, wurde unser gesamtes Deck von einer so heftigen und starken Welle überschwemmt, dass wir gezwungen waren, uns sofort in den Kabinen zu verstecken.
Das Schiff war so tief im Sand versunken, dass es keinen Sinn machte, auch nur daran zu denken, es aus dem Sand zu ziehen. Uns blieb nur noch eines: Sich darum zu kümmern, unser eigenes Leben zu retten. Wir hatten zwei Boote. Einer hing hinter dem Heck; Während eines Sturms wurde es zerbrochen und ins Meer getragen. Es war noch eins übrig, aber niemand wusste, ob es möglich sein würde, es zu starten. In der Zwischenzeit blieb keine Zeit zum Nachdenken: Das Schiff könnte jede Minute in zwei Teile teilen.
Der Assistent des Kapitäns eilte zum Boot und warf es mit Hilfe der Matrosen über Bord. Wir alle, elf Personen, bestiegen das Boot und ergaben uns dem Willen der tosenden Wellen, denn obwohl der Sturm bereits abgeklungen war, strömten immer noch riesige Wellen ans Ufer und das Meer konnte man mit Fug und Recht als verrückt bezeichnen.
Unsere Situation wurde noch schlimmer: Wir sahen deutlich, dass das Boot kurz vor der Überflutung stand und es für uns unmöglich war, zu entkommen. Wir hatten kein Segel, und selbst wenn wir eines hätten, wäre es für uns völlig nutzlos gewesen. Mit Verzweiflung im Herzen ruderten wir zum Ufer, wie Menschen, die zur Hinrichtung geführt werden. Wir alle wussten, dass die Brandung das Boot sofort in Stücke zerschmettern würde, sobald es sich dem Boden näherte. Vom Wind getrieben, stützten wir uns auf die Ruder und brachten so unseren eigenen Tod näher.
So trugen wir uns etwa vier Meilen weit, und plötzlich lief eine wütende Welle, hoch wie ein Berg, vom Heck auf unser Boot. Dies war der letzte, tödliche Schlag. Das Boot kenterte. In diesem Moment befanden wir uns unter Wasser. Der Sturm zerstreute uns innerhalb einer Sekunde in verschiedene Richtungen.
Es ist unmöglich, die Verwirrung der Gefühle und Gedanken zu beschreiben, die ich erlebte, als die Welle mich bedeckte. Ich bin ein sehr guter Schwimmer, aber ich hatte nicht die Kraft, sofort aus diesem Abgrund wieder aufzutauchen, um wieder zu Atem zu kommen, und wäre fast erstickt. Die Welle hob mich auf, zog mich zu Boden, brach ab und spülte mich weg, so dass ich halb tot zurückblieb, weil ich Wasser geschluckt hatte. Ich holte Luft und kam ein wenig zur Besinnung. Als ich sah, dass das Land so nah war (viel näher als ich erwartet hatte), sprang ich auf und machte mich mit äußerster Eile auf den Weg zum Ufer. Ich hoffte, es zu erreichen, bevor eine weitere Welle kam und mich erfasste, aber mir wurde bald klar, dass ich ihr nicht entkommen konnte: Das Meer kam auf mich zu wie ein großer Berg; es überholte mich wie ein erbitterter Feind, gegen den man nicht kämpfen konnte. Ich widerstand den Wellen nicht, die mich ans Ufer trugen; Aber sobald sie das Land verließen und zurückkehrten, zappelte ich und kämpfte auf jede erdenkliche Weise, damit sie mich nicht zurück ins Meer brachten.

Die nächste Welle war riesig: mindestens sechs bis zehn Meter hoch. Sie begrub mich tief unter sich. Dann wurde ich hochgehoben und mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit zu Boden geschleudert. Lange Zeit schwamm ich mit aller Kraft mit der Strömung mit und wäre im Wasser fast erstickt, als ich plötzlich das Gefühl hatte, irgendwohin nach oben getragen zu werden. Zu meinem größten Glück befanden sich bald meine Hände und mein Kopf über der Wasseroberfläche, und obwohl mich nach zwei Sekunden eine weitere Welle traf, gab mir diese kurze Atempause immer noch Kraft und Kraft.
Eine neue Welle bedeckte mich erneut vollständig, aber dieses Mal blieb ich nicht so lange unter Wasser. Als die Welle brach und nachließ, gab ich ihrem Druck nicht nach, sondern schwamm zum Ufer und spürte bald wieder, dass die Erde unter meinen Füßen lag.
Ich stand zwei, drei Sekunden da, holte tief Luft und rannte mit letzter Kraft zum Ufer.
Aber auch jetzt konnte ich dem wütenden Meer nicht entkommen: Es machte sich erneut auf den Weg hinter mir her. Noch zweimal überholten mich die Wellen und trugen mich zum Ufer, das an dieser Stelle sehr steil war.
Die letzte Welle warf mich mit solcher Wucht gegen den Felsen, dass ich das Bewusstsein verlor.
Eine Zeit lang war ich völlig hilflos, und wenn es mir in diesem Moment noch einmal gelungen wäre, das Meer anzugreifen, wäre ich mit Sicherheit im Wasser ertrunken. Glücklicherweise kam mein Bewusstsein rechtzeitig zurück. Als ich sah, dass die Welle mich wieder bedecken würde, hielt ich mich fest am Felsvorsprung fest und versuchte mit angehaltenem Atem zu warten, bis sie nachließ.
Hier, näher am Land, waren die Wellen nicht so groß. Als das Wasser nachließ, rannte ich wieder vorwärts und befand mich so nah am Ufer, dass die nächste Welle mich zwar am ganzen Körper überschwemmte, mich aber nicht mehr aufs Meer hinaustragen konnte.
Ich lief noch ein paar Schritte und spürte voller Freude, dass ich auf festem Boden stand. Ich begann, die Küstenfelsen zu erklimmen, und als ich einen hohen Hügel erreichte, fiel ich ins Gras. Hier war ich in Sicherheit: Das Wasser konnte mich nicht erreichen.

Ich glaube, es gibt keine Worte, die die freudigen Gefühle eines Menschen beschreiben könnten, der sozusagen aus dem Grab auferstanden ist! Ich begann zu rennen und zu springen, ich wedelte mit den Armen, ich sang und tanzte sogar. Mein ganzes Wesen war sozusagen von Gedanken an meine glückliche Erlösung verzehrt.
Doch dann dachte ich plötzlich an meine ertrunkenen Kameraden. Sie taten mir leid, denn während der Reise hatte ich eine Bindung zu vielen von ihnen aufgebaut. Ich erinnerte mich an ihre Gesichter und Namen. Leider habe ich keinen von ihnen wieder gesehen; Von ihnen blieben keine Spuren übrig, außer drei Hüten, die ihnen gehörten, einer Mütze und zwei unpaarigen Schuhen, die das Meer an Land geworfen hatte.
Als ich zu unserem Schiff blickte, konnte ich es hinter dem Kamm der hohen Wellen kaum erkennen – es war so weit weg! Und ich sagte mir: „Was für ein Glück, großes Glück, dass ich in einem solchen Sturm dieses ferne Ufer erreicht habe!“ Nachdem ich mit diesen Worten meine glühende Freude über die Befreiung von der tödlichen Gefahr zum Ausdruck gebracht hatte, erinnerte ich mich daran, dass das Land so schrecklich sein kann wie das Meer, dass ich nicht weiß, wo ich gelandet bin, und dass ich das unbekannte Gelände in einem sorgfältig untersuchen muss sehr kurze Zeit.
Sobald ich darüber nachdachte, kühlte meine Begeisterung sofort ab: Mir wurde klar, dass ich zwar mein Leben gerettet hatte, aber nicht vor Unglück, Not und Schrecken gerettet worden war. Alle meine Klamotten waren durchnässt und ich hatte nichts zum Anziehen. Ich hatte weder Essen noch frisches Wasser, um meine Kräfte aufzufrischen. Welche Zukunft erwartete mich? Entweder werde ich vor Hunger sterben oder von wilden Tieren in Stücke gerissen werden. Und was am traurigsten ist, ich konnte kein Wild jagen, ich konnte mich nicht gegen Tiere verteidigen, da ich keine Waffen bei mir hatte. Im Allgemeinen hatte ich außer einem Messer und einer Dose Tabak nichts bei mir.
Das brachte mich so in Verzweiflung, dass ich begann, wie verrückt am Ufer entlang zu rennen.
Die Nacht nahte und ich fragte mich traurig: „Was erwartet mich, wenn es in dieser Gegend wilde Tiere gibt?“ Schließlich gehen sie immer nachts auf die Jagd.“
In der Nähe stand ein breiter, verzweigter Baum. Ich beschloss, darauf zu klettern und bis zum Morgen zwischen seinen Ästen zu sitzen. Mir fiel nichts anderes ein, um mich vor den Tieren zu retten. „Und wenn der Morgen kommt“, sagte ich mir, „werde ich Zeit haben, darüber nachzudenken, was für einen Tod mir bevorsteht, denn es ist unmöglich, an diesen verlassenen Orten zu leben.“
Ich war durstig. Ich ging, um zu sehen, ob es in der Nähe frisches Wasser gab, und als ich mich eine Viertelmeile vom Ufer entfernte, entdeckte ich zu meiner großen Freude einen Bach.

Nachdem ich getrunken und Tabak in den Mund genommen hatte, um meinen Hunger zu stillen, kehrte ich zum Baum zurück, kletterte darauf und ließ mich in seinen Zweigen nieder, um nicht einzuschlafen. Dann schnitt er einen kurzen Ast ab, machte sich für den Fall eines feindlichen Angriffs eine Keule, setzte sich bequem hin und schlief vor schrecklicher Müdigkeit tief und fest ein.
Ich habe wunderbar geschlafen, da nicht viele Menschen in einem so unbequemen Bett geschlafen hätten, und es ist unwahrscheinlich, dass jemand nach einer solchen Übernachtung so frisch und gestärkt aufwachen würde.
Robinson auf einer einsamen Insel. – Er holt Dinge vom Schiff und baut sich ein Zuhause
Ich wachte spät auf. Das Wetter war klar, der Wind hatte nachgelassen und das Meer hatte aufgehört zu toben.
Ich schaute auf das verlassene Schiff und stellte zu meiner Überraschung fest, dass es nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz stand. Jetzt wurde er näher ans Ufer gespült. Er befand sich nicht weit von genau dem Felsen entfernt, gegen den mich die Welle beinahe geschleudert hätte. Die Flut muss ihn in der Nacht hochgehoben, verdrängt und hierher gebracht haben. Jetzt stand er nicht mehr als eine Meile von dem Ort entfernt, an dem ich die Nacht verbrachte. Die Wellen haben es offensichtlich nicht gebrochen: Es schwamm fast gerade auf dem Wasser.
Ich entschloss mich sofort, auf das Schiff zu gehen, um mich mit Proviant und diversen anderen Dingen einzudecken.
Nachdem ich vom Baum herabgestiegen war, sah ich mich noch einmal um. Das erste, was ich sah, war unser Boot, das auf der rechten Seite am Ufer lag, zwei Meilen entfernt – dorthin, wo der Hurrikan es hingeschleudert hatte. Ich wollte gerade in diese Richtung gehen, aber es stellte sich heraus, dass man nicht auf direktem Weg dorthin gelangen konnte: Eine Bucht von einer halben Meile Breite schnitt tief ins Ufer ein und versperrte den Weg. Ich kehrte um, weil es für mich viel wichtiger war, zum Schiff zu gelangen: Ich hoffte, dort Nahrung zu finden.
Am Nachmittag ließen die Wellen vollständig nach und die Flut war so stark, dass ich auf trockenem Grund eine Viertelmeile bis zum Schiff zurücklegte.
Auch hier tat mir das Herz weh: Mir wurde klar, dass wir jetzt alle am Leben wären, wenn wir nicht vom Sturm erschreckt worden wären und unser Schiff nicht verlassen hätten. Wir mussten nur darauf warten, dass der Sturm vorüberzog, und wir würden sicher das Ufer erreichen, und jetzt wäre ich nicht gezwungen, in dieser verlassenen Wüste in Armut zu leben.
Beim Gedanken an meine Einsamkeit fing ich an zu weinen, aber da ich mich daran erinnerte, dass Tränen niemals Unglück aufhalten, beschloss ich, meinen Weg fortzusetzen und um jeden Preis zu dem kaputten Schiff zu gelangen. Nachdem ich mich ausgezogen hatte, ging ich ins Wasser und schwamm.
Doch das Schwierigste kam noch: Ich konnte das Schiff nicht betreten. Er stand an einer flachen Stelle, sodass er fast vollständig aus dem Wasser ragte und es nichts gab, woran er sich festhalten konnte. Ich schwamm lange darum herum und bemerkte plötzlich ein Schiffsseil (ich wunderte mich, dass es mir nicht sofort ins Auge fiel!). Das Seil hing an der Luke und sein Ende befand sich so hoch über dem Wasser, dass es mir mit größter Mühe gelang, es zu fangen. Ich kletterte am Seil zum Cockpit. Der Unterwasserteil des Schiffes wurde durchbrochen und der Laderaum füllte sich mit Wasser. Das Schiff stand auf einer harten Sandbank, sein Heck hob sich stark und sein Bug berührte fast das Wasser. Dadurch gelangte kein Wasser ins Heck und nichts von dem, was sich dort befand, wurde nass. Ich beeilte mich dorthin, denn ich wollte zunächst einmal herausfinden, welche Dinge verdorben waren und welche überlebt hatten. Es stellte sich heraus, dass der gesamte Vorrat an Schiffsproviant völlig trocken blieb. Und da mich der Hunger quälte, ging ich als Erstes in die Speisekammer, holte ein paar Cracker und aß, während ich weiter das Schiff inspizierte, unterwegs, um keine Zeit zu verschwenden. In der Offiziersmesse fand ich eine Flasche Rum und trank ein paar gute Schlucke daraus, da ich für die anstehende Arbeit unbedingt Verstärkung brauchte.
Zunächst brauchte ich ein Boot, um die Dinge zu transportieren, die ich an Land brauchen könnte. Aber es gab nirgendwo ein Boot, und es war sinnlos, sich das Unmögliche zu wünschen. Es war notwendig, sich etwas anderes einfallen zu lassen. Das Schiff hatte Ersatzmasten, Topmasten und Rahen. Ich beschloss, aus diesem Material ein Floß zu bauen und machte mich eifrig an die Arbeit. Das Cockpit ist ein Raum für Segler am Bug des Schiffes.
Nachdem ich mehrere leichtere Baumstämme ausgewählt hatte, warf ich sie über Bord, nachdem ich zuvor jeden Baumstamm mit einem Seil festgebunden hatte, damit sie nicht weggetragen wurden. Dann stieg ich vom Schiff ab, zog vier Baumstämme zu mir heran, band sie an beiden Enden fest und befestigte sie oben mit zwei oder drei kreuzweise gelegten Brettern, und ich bekam so etwas wie ein Floß.
Dieses Floß trug mich perfekt, aber für eine große Ladung war es zu leicht und zu klein.
Ich musste wieder auf das Schiff klettern. Dort fand ich die Zimmermannssäge unseres Schiffes und sägte den Ersatzmast in drei Baumstämme, die ich am Floß befestigte. Das Floß wurde breiter und deutlich stabiler. Diese Arbeit kostete mich enorme Anstrengungen, aber der Wunsch, mich mit allem Lebensnotwendigen einzudecken, unterstützte mich und ich tat, wozu ich unter normalen Umständen nicht die Kraft gehabt hätte.
Jetzt war mein Floß breit und stabil und konnte einer erheblichen Belastung standhalten.
Womit sollen wir dieses Floß beladen und was sollen wir tun, damit es nicht von der Flut weggespült wird? Wir hatten lange Zeit keine Zeit zum Nachdenken, wir mussten uns beeilen.
Zuerst habe ich alle Bretter, die auf dem Schiff gefunden wurden, auf das Floß gelegt; Dann nahm er drei Truhen, die unseren Matrosen gehörten, brach die Schlösser auf und warf den gesamten Inhalt hinaus. Dann wählte ich die Dinge aus, die ich vielleicht am meisten brauchte, und füllte alle drei Truhen damit. In eine Truhe legte ich Lebensmittelvorräte: Reis, Cracker, drei Scheiben holländischen Käses, fünf große Stücke getrocknetes Ziegenfleisch, das als unser Hauptfleischnahrungsmittel auf dem Schiff diente, und die Reste von Gerste, die wir für das Schiff aus Europa mitgebracht hatten Hühner auf dem Schiff; Wir haben die Hühner schon vor langer Zeit gegessen, aber es war noch etwas Getreide übrig. Diese Gerste wurde mit Weizen vermischt; Es wäre mir sehr nützlich gewesen, aber leider wurde es, wie sich später herausstellte, durch Ratten stark beschädigt. Außerdem fand ich mehrere Kisten Wein und bis zu sechs Gallonen Reisschnaps, die unserem Kapitän gehörten.
Ich habe diese Kisten auch auf dem Floß neben den Truhen platziert.
Während ich mit dem Laden beschäftigt war, begann die Flut zu steigen, und ich war traurig, als ich sah, dass mein Kaftan, mein Hemd und mein Leibchen, die ich am Ufer gelassen hatte, aufs Meer getragen wurden.
Jetzt bleiben mir nur noch Strümpfe und Hosen (Leinen, kurz bis zum Knie), die ich beim Schwimmen zum Schiff nicht ausgezogen habe. Dies brachte mich dazu, darüber nachzudenken, mich sowohl mit Kleidung als auch mit Lebensmitteln einzudecken. Jacken und Hosen gab es auf dem Schiff in ausreichender Anzahl, aber ich habe vorerst nur ein Paar mitgenommen, da mich viele andere Dinge und vor allem Arbeitsgeräte viel mehr lockten.
Nach langem Suchen fand ich unsere Schreinerkiste, und es war für mich ein wirklich kostbarer Fund, den ich damals nicht gegen ein ganzes Schiff voller Gold eingetauscht hätte. Ich stellte diese Kiste auf das Floß, ohne überhaupt hineinzuschauen, da ich genau wusste, welche Werkzeuge sich darin befanden.
Jetzt musste ich mich nur noch mit Waffen und Munition eindecken. In der Hütte fand ich zwei gute Jagdgewehre und zwei Pistolen, die ich zusammen mit einer Pulverflasche, einer Tüte Schrot und zwei alten, rostigen Schwertern auf das Floß legte. Ich wusste, dass wir drei Fässer Schießpulver auf dem Schiff hatten, aber ich wusste nicht, wo sie gelagert wurden. Nach einer gründlichen Suche wurden jedoch alle drei Fässer gefunden. Einer erwies sich als nass und zwei waren trocken, und ich schleppte sie zusammen mit Waffen und Schwertern auf das Floß. Nun war mein Floß ausreichend beladen und ich musste mich auf den Weg machen. Mit einem Floß ohne Segel und ohne Ruder ans Ufer zu gelangen, ist keine leichte Aufgabe: Der schwächste Gegenwind reichte aus, um mein gesamtes Gebilde zum Kentern zu bringen.
Zum Glück war das Meer ruhig. Es kam die Flut, die mich zum Ufer treiben sollte. Zudem kam eine leichte Brise auf, ebenfalls günstig. Deshalb nahm ich die kaputten Ruder vom Schiffsboot mit und machte mich eilig auf den Rückweg. Bald gelang es mir, eine kleine Bucht zu entdecken, zu der ich mein Floß steuerte. Mit großer Mühe navigierte ich über die Strömung und gelangte schließlich in diese Bucht, wobei ich mein Ruder auf dem Grund ablegte, da es hier flach war; Sobald die Flut nachzulassen begann, landete mein Floß mit seiner gesamten Ladung an einem trockenen Ufer.
Jetzt musste ich die Umgebung erkunden und einen geeigneten Wohnort auswählen – einen, an dem ich mein gesamtes Eigentum unterbringen konnte, ohne befürchten zu müssen, dass es zugrunde geht. Ich wusste immer noch nicht, wo ich gelandet war: auf dem Festland oder auf der Insel. Wohnen hier Menschen? Gibt es hier Raubtiere? Eine halbe Meile oder etwas weiter entfernt befand sich ein steiler und hoher Hügel. Ich beschloss, hinaufzusteigen, um mich umzusehen. Mit einer Waffe, einer Pistole und einer Pulverflasche ging ich auf Erkundungstour.
Es war schwierig, den Gipfel des Hügels zu erklimmen. Als ich endlich hinaufstieg, sah ich, was für ein bitteres Schicksal mich ereilt hatte: Ich befand mich auf einer Insel! Das Meer breitete sich rundherum nach allen Seiten aus, und dahinter war nirgendwo Land zu sehen, abgesehen von mehreren in der Ferne hervorstehenden Riffen und zwei Inseln, die etwa neun Meilen westlich lagen. Diese Inseln waren klein, viel kleiner als meine.
Eine weitere Entdeckung machte ich: Die Vegetation auf der Insel war wild, nirgends war ein einziges Stück Kulturland zu sehen! Das bedeutet, dass hier wirklich keine Menschen waren!
Auch hier schien es keine Raubtiere zu geben, zumindest fielen mir keine auf. Aber es gab eine Menge Vögel, allesamt Arten, die mir unbekannt waren, so dass ich später, als ich einen Vogel erschoss, nie anhand seines Aussehens feststellen konnte, ob sein Fleisch als Nahrung geeignet war oder nicht. Als ich den Hügel hinunterstieg, schoss ich einen Vogel, einen sehr großen: Er saß auf einem Baum am Waldrand.
Ich glaube, das war der erste Schuss, der an diesen wilden Orten zu hören war. Bevor ich Zeit zum Fotografieren hatte, schwebte eine Vogelwolke über dem Wald. Jeder schrie auf seine eigene Weise, aber keiner dieser Schreie klang wie die Schreie von Vögeln, die ich kannte.
Der Vogel, den ich getötet habe, ähnelte sowohl in der Farbe seiner Federn als auch in der Form seines Schnabels unserem europäischen Habicht. Nur ihre Krallen waren viel kürzer. Sein Fleisch schmeckte nach Aas und ich konnte es nicht essen.
Dies waren die Entdeckungen, die ich am ersten Tag machte. Dann kehrte ich zum Floß zurück und begann, Dinge an Land zu schleppen. Das hat mich den Rest des Tages gekostet.
Gegen Abend begann ich wieder darüber nachzudenken, wie und wo ich mich für die Nacht niederlassen sollte.
Ich hatte Angst, direkt auf dem Boden zu liegen: Was wäre, wenn ich Gefahr liefe, von einem Raubtier angegriffen zu werden? Nachdem ich mir einen geeigneten Ort zum Übernachten am Ufer ausgesucht hatte, blockierte ich ihn von allen Seiten mit Truhen und Kisten und baute innerhalb dieses Zauns so etwas wie eine Hütte aus Brettern.

Ich machte mir auch Sorgen darüber, wie ich an Nahrung kommen würde, wenn meine Vorräte zur Neige gingen: Außer Vögeln und zwei Tieren, wie unserem Hasen, die beim Geräusch meines Schusses aus dem Wald sprangen, sah ich keine Lebewesen Hier.
Im Moment interessierte mich jedoch viel mehr etwas anderes. Ich habe nicht alles mitgenommen, was vom Schiff mitgenommen werden konnte; Dort waren noch viele Dinge übrig, die mir nützlich sein könnten, vor allem Segel und Seile. Deshalb beschloss ich, das Schiff noch einmal zu besuchen, wenn mich nichts aufhalten würde. Ich war mir sicher, dass es beim ersten Sturm in Stücke gerissen werden würde. Es war notwendig, alle anderen Dinge beiseite zu legen und eilig mit dem Entladen des Schiffes zu beginnen. Ich kann mich nicht beruhigen, bis ich alle meine Sachen bis zum letzten Nagel an Land gebracht habe. Nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, begann ich darüber nachzudenken, ob ich wie beim ersten Mal auf ein Floß gehen oder schwimmen sollte. Ich entschied, dass es bequemer wäre, schwimmen zu gehen. Nur dieses Mal zog ich mich in der Hütte aus und blieb nur mit dem unteren karierten Hemd, den Leinenhosen und den Lederschuhen an meinen nackten Füßen zurück. Wie beim ersten Mal kletterte ich per Seil auf das Schiff, baute dann ein neues Floß zusammen und transportierte darauf viele nützliche Dinge. Zuerst schnappte ich mir alles, was wir in unserem Zimmermannsschrank fanden, nämlich zwei oder drei Tüten mit Nägeln (groß und klein), einen Schraubenzieher, zwei Dutzend Äxte und vor allem so etwas Nützliches wie einen Spitzer.
Dann schnappte ich mir mehrere Dinge, die ich von unserem Schützen gefunden hatte: drei Eisenstücke, zwei Fässer mit Gewehrkugeln und etwas Schießpulver. Dann habe ich auf dem Schiff einen ganzen Haufen Kleidung aller Art gefunden und mir auch ein Ersatzsegel, eine Hängematte, mehrere Matratzen und Kissen geschnappt. Ich habe das alles auf das Floß gelegt und es zu meiner großen Freude unversehrt ans Ufer gebracht. Als ich zum Schiff ging, hatte ich Angst, dass in meiner Abwesenheit einige Raubtiere die Vorräte angreifen würden. Glücklicherweise ist dies nicht geschehen.
Nur ein Tier kam aus dem Wald gerannt und setzte sich auf eine meiner Truhen. Als er mich sah, rannte er ein wenig zur Seite, blieb aber sofort stehen, stellte sich auf die Hinterbeine und blickte mir mit unerschütterlicher Ruhe, ohne jede Angst, in die Augen, als wollte er mich kennenlernen.
Das Tier war wunderschön, wie eine Wildkatze. Ich richtete meine Waffe auf ihn, aber er rührte sich nicht einmal, da er sich der Gefahr, die ihm drohte, nicht bewusst war. Dann warf ich ihm ein Stück Cracker zu, obwohl das für mich unvernünftig war, da ich nicht genug Cracker hatte und sie hätte aufheben sollen. Trotzdem gefiel mir das Tier so gut, dass ich ihm dieses Stück Cracker schenkte. Er rannte hin, schnupperte an dem Cracker, aß ihn und leckte ihn mit großer Freude ab. Es war klar, dass er auf die Fortsetzung wartete. Aber ich habe ihm nichts anderes gegeben. Er saß eine Weile da und ging.
Danach begann ich, mir ein Zelt zu bauen. Ich habe es aus einem Segel und Stangen gemacht, die ich im Wald geschnitten habe. Ich brachte alles, was durch Sonne und Regen beschädigt werden konnte, in das Zelt und stapelte leere Kisten und Truhen darum herum, für den Fall eines plötzlichen Angriffs von Menschen oder wilden Tieren.
Den Eingang zum Zelt habe ich von außen mit einer großen Truhe seitlich versperrt und von innen mit Brettern versperrt. Dann breitete ich das Bett auf dem Boden aus, platzierte zwei Pistolen am Kopfende des Bettes, eine Waffe neben dem Bett und legte mich hin.
Dies war die erste Nacht, die ich nach dem Schiffbruch im Bett verbrachte. Ich habe bis zum Morgen tief und fest geschlafen, da ich in der Nacht zuvor nur sehr wenig geschlafen hatte, und den ganzen Tag ohne Pause gearbeitet: Zuerst habe ich Dinge vom Schiff auf das Floß geladen und sie dann ans Ufer transportiert.
Ich glaube, niemand hatte ein so großes Lager an Dingen wie ich jetzt. Aber alles schien mir nicht genug. Das Schiff war unversehrt, und solange es nicht abdriftete, solange noch wenigstens ein Ding an Bord war, das ich gebrauchen konnte, hielt ich es für notwendig, alles, was möglich war, von dort ans Ufer zu bringen. Deshalb bin ich jeden Tag bei Ebbe dorthin gefahren und habe immer mehr neue Dinge mitgebracht.
Meine dritte Reise war besonders erfolgreich. Ich habe die gesamte Ausrüstung abgebaut und alle Seile mitgenommen. Diesmal brachte ich ein großes Stück Ersatzsegeltuch mit, das wir zum Reparieren der Segel verwendeten, und ein Fass nasses Schießpulver, das ich auf dem Schiff gelassen hatte. Am Ende habe ich alle Segel an Land gebracht; Ich musste sie nur noch in Stücke schneiden und Stück für Stück transportieren. Ich habe es jedoch nicht bereut: Ich brauchte die Segel nicht für die Navigation, und ihr ganzer Wert lag für mich in der Leinwand, aus der sie gefertigt waren.
Jetzt wurde absolut alles vom Schiff genommen, was eine Person heben konnte. Übrig blieben nur die sperrigen Dinge, die ich beim nächsten Flug in Angriff nehmen wollte. Ich begann mit den Seilen. Ich habe jedes Seil in so große Stücke geschnitten, dass es für mich nicht allzu schwierig wäre, sie zu handhaben, und ich habe drei Seile in Stücken transportiert. Außerdem habe ich vom Schiff alle Eisenteile mitgenommen, die ich mit einer Axt abreißen konnte. Dann, nachdem ich alle restlichen Rahen abgeschnitten hatte, baute ich daraus ein größeres Floß, lud all diese Gewichte darauf und machte mich auf den Rückweg.
Doch dieses Mal hat mich das Glück verraten: Mein Floß war so schwer beladen, dass ich es nur sehr schwer kontrollieren konnte.
Als ich mich nach der Einfahrt in die Bucht dem Ufer näherte, wo der Rest meines Eigentums gelagert war, kenterte das Floß und ich fiel mit meiner gesamten Ladung ins Wasser. Ich konnte nicht ertrinken, da es nicht weit vom Ufer entfernt passierte, aber fast meine gesamte Ladung landete unter Wasser; Am wichtigsten war, dass das Eisen, das ich so sehr schätzte, sank.
Als die Flut zu ebben begann, zog ich zwar fast alle Seilstücke und mehrere Eisenstücke an Land, aber ich musste für jedes Stück tauchen, was mich sehr ermüdete.
Meine Fahrten zum Schiff gingen Tag für Tag weiter und jedes Mal brachte ich etwas Neues mit.
Ich lebe bereits seit dreizehn Tagen auf der Insel und war in dieser Zeit elf Mal auf dem Schiff und habe absolut alles an Land gezogen, was ein Paar Menschenhände heben kann. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich das gesamte Schiff Stück für Stück transportiert hätte, wenn das ruhige Wetter länger gedauert hätte.
Während ich mich auf den zwölften Flug vorbereitete, bemerkte ich, dass der Wind zunahm. Trotzdem ging ich, nachdem ich auf das Ende der Flut gewartet hatte, zum Schiff. Bei meinen vorherigen Besuchen habe ich unsere Hütte so gründlich durchsucht, dass es mir vorkam, als sei es unmöglich, dort etwas zu finden. Doch plötzlich fiel mir ein kleiner Schrank mit zwei Schubladen ins Auge: In einer fand ich drei Rasierer, Scheren und etwa ein Dutzend gute Gabeln und Messer; In einer anderen Kiste befand sich Geld, teils europäische, teils brasilianische Silber- und Goldmünzen im Gesamtwert von sechsunddreißig Pfund Sterling.
Ich grinste beim Anblick dieses Geldes.
„Du wertloser Müll“, sagte ich, „wofür brauche ich dich jetzt?“ Für jedes dieser Penny-Messer würde ich gerne eine ganze Menge Gold geben. Ich kann dich nirgendwo unterbringen. Also geh auf den Meeresgrund. Wenn Sie auf dem Boden liegen würden, würde es sich wirklich nicht lohnen, sich zu bücken, um Sie hochzuheben.
Aber nachdem ich ein wenig nachgedacht hatte, wickelte ich das Geld trotzdem in ein Stück Leinwand und nahm es mit.
Das Meer tobte die ganze Nacht, und als ich morgens aus meinem Zelt schaute, war vom Schiff keine Spur mehr übrig. Jetzt konnte ich mich voll und ganz mit der Frage auseinandersetzen, die mich seit dem ersten Tag beschäftigte: Was sollte ich tun, damit mich weder Raubtiere noch wilde Menschen angreifen? Welche Art von Wohnraum soll ich organisieren? Eine Höhle graben oder ein Zelt aufschlagen?
Am Ende habe ich mich für beides entschieden.
Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass der von mir gewählte Ort am Ufer nicht für den Bau einer Behausung geeignet war: Es war ein sumpfiger, tief gelegener Ort, nahe am Meer. Das Leben an solchen Orten ist sehr schädlich. Außerdem gab es kein Süßwasser in der Nähe. Ich beschloss, ein anderes, besser zum Wohnen geeignetes Stück Land zu finden. Ich wollte, dass mein Zuhause vor der Hitze der Sonne und vor Raubtieren geschützt ist. damit es an einem Ort steht, an dem es keine Feuchtigkeit gibt; damit frisches Wasser in der Nähe ist. Außerdem wollte ich unbedingt, dass das Meer von meinem Haus aus sichtbar ist.
Ende der kostenlosen Testversion.
Kapitel 1
Familie Robinson. – Seine Flucht aus dem Haus seiner Eltern

Seit meiner frühen Kindheit liebte ich das Meer mehr als alles andere auf der Welt. Ich beneidete jeden Seemann, der sich auf eine lange Reise begab. Stundenlang stand ich am Meeresufer und ließ die vorbeifahrenden Schiffe nicht aus den Augen.
Meinen Eltern gefiel es nicht besonders. Mein Vater, ein alter, kranker Mann, wollte, dass ich ein wichtiger Beamter werde, am königlichen Hof diente und ein hohes Gehalt bekäme. Aber ich habe von Seereisen geträumt. Es schien mir das größte Glück zu sein, durch die Meere und Ozeane zu wandern.
Mein Vater erriet, was mir durch den Kopf ging. Eines Tages rief er mich an und sagte wütend:
– Ich weiß: Du willst von zu Hause weglaufen. Das ist verrückt. Du musst bleiben. Wenn du bleibst, werde ich dir ein guter Vater sein, aber wehe dir, wenn du wegläufst! „Hier zitterte seine Stimme und er fügte leise hinzu:
- Denken Sie an Ihre kranke Mutter ... Sie wird die Trennung von Ihnen nicht ertragen können.
Tränen funkelten in seinen Augen. Er liebte mich und wollte das Beste für mich.
Der alte Mann tat mir leid, ich beschloss fest, im Haus meiner Eltern zu bleiben und nicht mehr an Seereisen zu denken. Aber leider! – Mehrere Tage vergingen, und von meinen guten Vorsätzen blieb nichts übrig. Es zog mich wieder an die Meeresküste. Ich begann von Masten, Wellen, Segeln, Möwen, unbekannten Ländern und den Lichtern von Leuchttürmen zu träumen.
Zwei oder drei Wochen nach meinem Gespräch mit meinem Vater beschloss ich schließlich, wegzulaufen. Da ich eine Zeit wählte, in der meine Mutter fröhlich und ruhig war, ging ich auf sie zu und sagte respektvoll:
„Ich bin bereits achtzehn Jahre alt und diese Jahre sind zu spät, um das Richten zu erlernen. Selbst wenn ich irgendwo in den Dienst eingetreten wäre, wäre ich nach ein paar Jahren trotzdem in ferne Länder geflohen. Ich möchte so gerne fremde Länder sehen, sowohl Afrika als auch Asien besuchen! Selbst wenn ich an etwas hänge, habe ich immer noch nicht die Geduld, es bis zum Ende durchzuziehen. Ich bitte Sie, meinen Vater zu überreden, mich zumindest für kurze Zeit zur Probe zur See fahren zu lassen; Wenn mir das Leben als Seemann nicht gefällt, werde ich nach Hause zurückkehren und nie woanders hingehen. Mein Vater soll mich freiwillig gehen lassen, sonst bin ich gezwungen, das Haus ohne seine Erlaubnis zu verlassen.
Meine Mutter wurde sehr wütend auf mich und sagte:
„Ich bin überrascht, wie du nach deinem Gespräch mit deinem Vater über Seereisen nachdenken kannst!“ Schließlich hat dein Vater verlangt, dass du die fremden Länder ein für alle Mal vergisst. Und er versteht besser als Sie, welches Geschäft Sie machen sollten. Wenn du dich selbst zerstören willst, geh natürlich auch in dieser Minute weg, aber du kannst sicher sein, dass dein Vater und ich deiner Reise niemals zustimmen werden. Und vergebens hofften Sie, dass ich Ihnen helfen würde. Nein, ich werde meinem Vater kein Wort über deine bedeutungslosen Träume sagen. Ich möchte nicht, dass du später, wenn das Leben auf See dich in Armut und Leid bringt, deiner Mutter Vorwürfe machen könntest, dass sie dich verwöhnt.
Dann, viele Jahre später, erfuhr ich, dass meine Mutter meinem Vater dennoch unser gesamtes Gespräch Wort für Wort übermittelte. Der Vater war traurig und sagte seufzend zu ihr:
– Ich verstehe nicht, was er will? In seiner Heimat konnte er leicht Erfolg und Glück erreichen. Wir sind keine reichen Leute, aber wir haben einige Mittel. Er kann bei uns leben, ohne etwas zu brauchen. Wenn er auf eine Reise geht, wird er große Strapazen erleben und bereuen, dass er nicht auf seinen Vater gehört hat. Nein, ich kann ihn nicht zur See fahren lassen. Weit weg von seiner Heimat wird er einsam sein, und wenn ihm Ärger widerfährt, wird er keinen Freund haben, der ihn trösten könnte. Und dann wird er seine Rücksichtslosigkeit bereuen, aber es wird zu spät sein!
Und doch lief ich nach ein paar Monaten von zu Hause weg. Es ist so passiert. Eines Tages fuhr ich für mehrere Tage in die Stadt Gull. Dort traf ich einen Freund, der mit dem Schiff seines Vaters nach London fahren wollte. Er begann mich zu überreden, mit ihm zu gehen, indem er mich mit der Tatsache in Versuchung führte, dass die Fahrt mit dem Schiff kostenlos sein würde.
Und so, ohne Vater oder Mutter zu fragen, zu einer unfreundlichen Stunde! - Am 1. September 1651, in meinem neunzehnten Lebensjahr, bestieg ich ein Schiff nach London.
Es war eine schlimme Tat: Ich habe meine alten Eltern schamlos im Stich gelassen, ihren Rat missachtet und meine kindliche Pflicht verletzt. Und ich musste sehr bald bereuen, was ich getan hatte.
Kapitel 2
Erste Abenteuer auf See
Kaum hatte unser Schiff die Mündung des Humber verlassen, wehte ein kalter Wind aus Norden. Der Himmel war mit Wolken bedeckt. Es begann eine kräftige Schaukelbewegung.
Ich war noch nie zuvor auf See gewesen und fühlte mich schlecht. Mein Kopf begann sich zu drehen, meine Beine begannen zu zittern, mir wurde übel und ich wäre fast gestürzt. Jedes Mal, wenn eine große Welle das Schiff traf, kam es mir vor, als würden wir sofort ertrinken. Jedes Mal, wenn ein Schiff von einem hohen Wellenkamm fiel, war ich mir sicher, dass es nie wieder aufstehen würde.
Tausendmal habe ich geschworen, dass ich, wenn ich am Leben bleibe, wenn ich wieder festen Boden betrete, sofort nach Hause zu meinem Vater zurückkehren und in meinem ganzen Leben nie wieder einen Fuß auf das Deck eines Schiffes setzen würde.
Diese klugen Gedanken hielten nur so lange an, wie der Sturm tobte.
Aber der Wind ließ nach, die Aufregung ließ nach und ich fühlte mich viel besser. Nach und nach gewöhnte ich mich an das Meer. Zwar war ich noch nicht ganz von der Seekrankheit befreit, aber am Ende des Tages hatte sich das Wetter aufgeklärt, der Wind hatte völlig nachgelassen und ein herrlicher Abend war angebrochen.
Ich habe die ganze Nacht tief und fest geschlafen. Am nächsten Tag war der Himmel genauso klar. Das ruhige Meer mit völliger Ruhe, alles von der Sonne beleuchtet, bot ein so schönes Bild, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Von meiner Seekrankheit war keine Spur mehr übrig. Ich beruhigte mich sofort und fühlte mich glücklich. Überrascht schaute ich mich auf dem Meer um, das gestern noch gewalttätig, grausam und bedrohlich wirkte, heute aber so sanft und sanft war.
Dann kommt wie mit Absicht mein Freund, der mich dazu verleitet hat, mit ihm zu gehen, auf mich zu, klopft mir auf die Schulter und sagt:
- Na, wie fühlst du dich, Bob? Ich wette, du hattest Angst. Geben Sie es zu: Sie hatten gestern große Angst, als der Wind wehte?
- Gibt es eine Brise? Schöne Brise! Es war ein toller Sturm. Ich könnte mir einen so schrecklichen Sturm gar nicht vorstellen!
- Stürme? Oh, du Narr! Glaubst du, das ist ein Sturm? Nun ja, Sie sind noch neu am Meer: Kein Wunder, dass Sie Angst haben ... Auf geht's, bestellen wir Punsch, trinken ein Glas und vergessen den Sturm. Schauen Sie, wie klar der Tag ist! Herrliches Wetter, nicht wahr?
Um diesen traurigen Teil meiner Geschichte abzukürzen, möchte ich nur sagen, dass es bei Seeleuten wie immer lief: Ich betrank mich und ertränkte alle meine Versprechen und Schwüre, alle meine lobenswerten Gedanken über die sofortige Rückkehr nach Hause im Wein. Sobald die Ruhe kam und ich keine Angst mehr hatte, dass die Wellen mich verschlucken würden, vergaß ich sofort alle meine guten Vorsätze.

Am sechsten Tag sahen wir in der Ferne die Stadt Yarmouth. Der Wind war nach dem Sturm Gegenwind, so dass wir sehr langsam vorankamen. In Yarmouth mussten wir vor Anker gehen. Wir standen sieben oder acht Tage lang da und warteten auf einen guten Wind.
In dieser Zeit kamen viele Schiffe aus Newcastle hierher. Wir hätten jedoch nicht so lange gestanden und wären mit der Flut in den Fluss gegangen, aber der Wind wurde frischer und nach fünf Tagen wehte er mit aller Kraft. Da die Anker und Ankertaue auf unserem Schiff stark waren, zeigten unsere Matrosen nicht die geringste Beunruhigung. Sie waren davon überzeugt, dass das Schiff absolut sicher war, und widmeten, wie es unter Seeleuten üblich war, ihre gesamte Freizeit lustigen Aktivitäten und Vergnügungen.
Am neunten Tag jedoch wurde der Wind am Morgen noch frischer und bald brach ein schrecklicher Sturm aus. Sogar die erfahrenen Segler hatten große Angst. Mehrmals hörte ich, wie unser Kapitän mich in die Kabine hinein- und hinausging und mit leiser Stimme murmelte: „Wir sind verloren!“ Wir sind verloren! Ende!"
Dennoch verlor er nicht den Kopf, beobachtete aufmerksam die Arbeit der Matrosen und ergriff alle Maßnahmen, um sein Schiff zu retten.
Bisher hatte ich keine Angst verspürt: Ich war mir sicher, dass dieser Sturm genauso sicher vorübergehen würde wie der erste. Doch als der Kapitän selbst verkündete, dass das Ende für uns alle gekommen sei, bekam ich schreckliche Angst und rannte aus der Kabine auf das Deck. Noch nie in meinem Leben habe ich einen so schrecklichen Anblick gesehen. Riesige Wellen bewegten sich wie hohe Berge über das Meer, und alle drei oder vier Minuten stürzte ein solcher Berg auf uns.
Zuerst war ich taub vor Angst und konnte mich nicht umsehen. Als ich es endlich wagte, zurückzublicken, wurde mir klar, was für eine Katastrophe über uns hereingebrochen war. Auf zwei schwer beladenen Schiffen, die in der Nähe vor Anker lagen, schnitten die Matrosen die Masten ab, um die Schiffe zumindest ein wenig von ihrem Gewicht zu entlasten.
Zwei weitere Schiffe verloren ihre Anker und wurden vom Sturm aufs Meer hinausgetragen. Was erwartete sie dort? Alle ihre Masten wurden durch den Hurrikan umgeworfen.
Kleinere Schiffe hielten sich besser, aber einige von ihnen mussten auch leiden: Zwei oder drei Boote trieben an unserer Seite vorbei direkt ins offene Meer.
Am Abend kamen der Navigator und der Bootsmann zum Kapitän und sagten ihm, dass es zur Rettung des Schiffes notwendig sei, den Fockmast abzuschneiden.
– Sie können keine Minute zögern! - Sie sagten. - Geben Sie die Bestellung auf und wir werden sie kürzen.
„Wir warten noch etwas“, wandte der Kapitän ein. „Vielleicht lässt der Sturm nach.“
Eigentlich wollte er den Mast nicht durchtrennen, aber der Bootsmann begann zu argumentieren, dass das Schiff sinken würde, wenn der Mast übrig bliebe – und der Kapitän stimmte widerwillig zu.
Und als der Fockmast abgeholzt wurde, begann der Großmast zu schwanken und das Schiff so stark zu schaukeln, dass auch er abgeholzt werden musste.
Die Nacht brach herein, und plötzlich schrie einer der Matrosen, als er in den Laderaum hinabstieg, dass das Schiff ein Leck gehabt habe. Ein anderer Seemann wurde in den Laderaum geschickt und berichtete, dass das Wasser bereits einen Meter gestiegen sei.
Dann befahl der Kapitän:
- Wasser abpumpen! Alles an die Pumpen!
Als ich diesen Befehl hörte, sank mein Herz vor Entsetzen: Es kam mir vor, als würde ich sterben, meine Beine gaben nach und ich fiel rücklings auf das Bett. Aber die Matrosen drängten mich beiseite und forderten, dass ich mich meiner Arbeit nicht entziehen sollte.
- Du warst genug untätig, jetzt ist es Zeit, hart zu arbeiten! - Sie sagten.
Es gab nichts zu tun, ich ging zur Pumpe und begann fleißig Wasser abzupumpen.
Zu dieser Zeit lichteten kleine Frachtschiffe, die dem Wind nicht widerstehen konnten, die Anker und fuhren aufs offene Meer hinaus.
Als unser Kapitän sie sah, befahl er, die Kanone abzufeuern, um ihnen mitzuteilen, dass wir in Lebensgefahr schwebten. Als ich eine Kanonensalve hörte und nicht verstand, was geschah, stellte ich mir vor, dass unser Schiff abgestürzt sei. Ich hatte solche Angst, dass ich ohnmächtig wurde und fiel. Aber damals war jeder besorgt, sein eigenes Leben zu retten, und sie schenkten mir keine Beachtung. Niemand war daran interessiert herauszufinden, was mit mir passiert ist. An meiner Stelle stand einer der Matrosen an der Pumpe und schob mich mit dem Fuß beiseite. Alle waren sich sicher, dass ich bereits tot war. Ich lag sehr lange so da. Als ich aufwachte, machte ich mich wieder an die Arbeit. Wir arbeiteten unermüdlich, doch das Wasser im Laderaum stieg immer höher.
Es war klar, dass das Schiff sinken würde. Zwar begann der Sturm etwas nachzulassen, aber wir hatten nicht die geringste Möglichkeit, bis zur Einfahrt in den Hafen auf dem Wasser zu bleiben. Deshalb hörte der Kapitän nicht auf, seine Kanonen abzufeuern, in der Hoffnung, dass uns jemand vor dem Tod retten würde.
Schließlich wagte das kleine Schiff, das uns am nächsten war, das Risiko, ein Boot herabzulassen, um uns zu helfen. Das Boot hätte jede Minute kentern können, aber es kam trotzdem auf uns zu. Leider konnten wir nicht hinein, da es keine Möglichkeit gab, an unserem Schiff festzumachen, obwohl die Menschen mit aller Kraft ruderten und ihr Leben riskierten, um unseres zu retten. Wir warfen ihnen ein Seil zu. Sie konnten ihn lange Zeit nicht einholen, da der Sturm ihn zur Seite riss. Doch zum Glück gelang es einem der Draufgänger, sich nach vielen erfolglosen Versuchen das Seil am Ende zu schnappen. Dann zogen wir das Boot unter unser Heck und jeder einzelne von uns stieg hinein. Wir wollten zu ihrem Schiff, aber wir konnten den Wellen nicht widerstehen und die Wellen trugen uns ans Ufer. Es stellte sich heraus, dass dies die einzige Richtung war, in die man rudern konnte. Es verging keine Viertelstunde, bis unser Schiff im Wasser zu versinken begann. Die Wellen, die unser Boot hin und her trieben, waren so hoch, dass wir das Ufer nicht sehen konnten. Erst in dem ganz kurzen Moment, als unser Boot auf dem Wellenkamm hochgeworfen wurde, konnten wir erkennen, dass sich eine große Menschenmenge am Ufer versammelt hatte: Menschen rannten hin und her und bereiteten sich darauf vor, uns zu helfen, wenn wir näher kamen. Aber wir bewegten uns sehr langsam in Richtung Ufer. Erst am Abend gelang es uns, an Land zu gelangen, und selbst dann unter größten Schwierigkeiten.
Wir mussten nach Yarmouth laufen. Dort erwartete uns ein herzlicher Empfang: Die Einwohner der Stadt, die bereits von unserem Unglück wussten, gaben uns eine gute Unterkunft, bewirteten uns mit einem hervorragenden Abendessen und versorgten uns mit Geld, damit wir dorthin gelangen konnten, wohin wir wollten – nach London oder nach Hull .
Nicht weit von Hull entfernt lag York, wo meine Eltern lebten, und natürlich hätte ich zu ihnen zurückkehren sollen. Sie würden mir meine unerlaubte Flucht verzeihen und wir wären alle so glücklich!
Aber der verrückte Traum von Seeabenteuern ließ mich auch jetzt noch nicht los. Obwohl mir die nüchterne Stimme der Vernunft sagte, dass mich auf See neue Gefahren und Probleme erwarteten, begann ich erneut darüber nachzudenken, wie ich auf ein Schiff steigen und die Meere und Ozeane der ganzen Welt bereisen könnte.
Mein Freund (derselbe, dessen Vater das verlorene Schiff besaß) war jetzt düster und traurig. Die Katastrophe, die passierte, deprimierte ihn. Er stellte mich seinem Vater vor, der ebenfalls nicht aufhörte, über das gesunkene Schiff zu trauern. Nachdem er von meinem Sohn von meiner Leidenschaft für Seereisen erfahren hatte, sah mich der alte Mann streng an und sagte:
„Junger Mann, du solltest nie wieder zur See fahren.“ Ich habe gehört, dass du feige und verwöhnt bist und bei der geringsten Gefahr den Mut verlierst. Solche Leute sind nicht geeignet, Seeleute zu sein. Kehren Sie schnell nach Hause zurück und versöhnen Sie sich mit Ihrer Familie. Sie haben aus erster Hand erfahren, wie gefährlich es ist, auf dem Seeweg zu reisen.
Ich hatte das Gefühl, dass er Recht hatte und konnte nichts dagegen haben. Trotzdem kehrte ich nicht nach Hause zurück, weil ich mich schämte, vor meinen Lieben zu erscheinen. Es schien mir, als würden alle unsere Nachbarn mich verspotten; Ich war mir sicher, dass meine Misserfolge mich zum Gespött aller meiner Freunde und Bekannten machen würden. In der Folge ist mir oft aufgefallen, dass Menschen, insbesondere in ihrer Jugend, nicht die skrupellosen Taten für beschämend halten, für die wir sie Narren nennen, sondern die guten und edlen Taten, die sie in Momenten der Reue begehen, obwohl sie nur für diese Taten als vernünftig bezeichnet werden können . So war ich damals. Die Erinnerungen an das Unglück, das ich während des Schiffbruchs erlebte, verblassten allmählich, und nachdem ich zwei oder drei Wochen in Yarmouth gelebt hatte, ging ich nicht nach Hull, sondern nach London.
Kapitel 3
Robinson wird gefangen genommen. - Flucht
Mein großes Unglück war, dass ich bei all meinen Abenteuern nicht als Seemann an Bord des Schiffes war. Zwar müsste ich mehr arbeiten, als ich es gewohnt bin, aber am Ende würde ich Seemannschaft lernen und könnte irgendwann Navigator und vielleicht sogar Kapitän werden. Aber ich war damals so unvernünftig, dass ich von allen Wegen immer den schlechtesten gewählt habe. Da ich damals schick gekleidet war und Geld in der Tasche hatte, kam ich immer als Faulenzer auf das Schiff: Ich habe dort nichts getan und nichts gelernt.
Junge Wildfang- und Faulenzer geraten meist in schlechte Gesellschaft und verirren sich innerhalb kürzester Zeit völlig. Das gleiche Schicksal erwartete mich, aber glücklicherweise gelang es mir bei meiner Ankunft in London, einen angesehenen älteren Kapitän zu treffen, der eine große Anteilnahme an mir hatte. Kurz zuvor segelte er mit seinem Schiff an die Küste Afrikas, nach Guinea. Diese Reise brachte ihm beträchtlichen Gewinn, und nun wollte er erneut in die gleiche Region reisen.
Er mochte mich, weil ich damals ein guter Gesprächspartner war. Er verbrachte oft seine Freizeit mit mir und als er erfuhr, dass ich überseeische Länder sehen wollte, lud er mich ein, mit seinem Schiff in See zu stechen.
„Es wird dich nichts kosten“, sagte er, „Ich werde kein Geld von dir für Reisen oder Essen nehmen.“ Du wirst mein Gast auf dem Schiff sein. Wenn Sie einige Dinge mitnehmen und es schaffen, diese in Guinea sehr gewinnbringend zu verkaufen, erhalten Sie den gesamten Gewinn. Versuchen Sie Ihr Glück – vielleicht haben Sie Glück.
Da dieser Kapitän das allgemeine Vertrauen genoss, nahm ich seine Einladung gerne an.
Als ich nach Guinea ging, nahm ich einige Waren mit: Ich kaufte für vierzig Pfund Sterling verschiedene Schmuckstücke und Glasgegenstände, die sich unter den Wilden gut verkauften.
Diese vierzig Pfund erhielt ich mit der Hilfe naher Verwandter, mit denen ich in Briefwechsel stand: Ich teilte ihnen mit, dass ich Handel treiben würde, und sie überredeten meine Mutter und vielleicht auch meinen Vater, mir zumindest mit einem kleinen Betrag zu helfen in meinem ersten Unternehmen.
Diese Reise nach Afrika war sozusagen meine einzige erfolgreiche Reise. Natürlich verdankte ich meinen Erfolg ausschließlich der Selbstlosigkeit und Freundlichkeit des Kapitäns.
Während der Reise lernte er bei mir Mathematik und brachte mir Schiffbau bei. Es hat ihm Spaß gemacht, seine Erfahrungen mit mir zu teilen, und ich habe es genossen, ihm zuzuhören und von ihm zu lernen.
Die Reise machte mich sowohl zum Seemann als auch zum Kaufmann: Ich tauschte fünf Pfund und neun Unzen Goldstaub gegen meine Schmuckstücke, für die ich bei meiner Rückkehr nach London eine angemessene Summe erhielt.
Doch zu meinem Unglück starb mein Freund, der Kapitän, kurz nach meiner Rückkehr nach England, und ich war gezwungen, eine zweite Reise alleine zu unternehmen, ohne freundlichen Rat und Hilfe.
Ich bin mit demselben Schiff von England aus gesegelt. Es war die elendste Reise, die der Mensch je unternommen hat.
Eines Tages im Morgengrauen, als wir nach einer langen Reise zwischen den Kanarischen Inseln und Afrika unterwegs waren, wurden wir von Piraten – Seeräubern – angegriffen. Das waren Türken aus Saleh. Sie bemerkten uns schon von weitem und machten sich mit vollen Segeln auf den Weg zu uns.
Wir hofften zunächst, dass wir ihnen durch die Flucht entkommen könnten, und setzten auch alle Segel. Aber es wurde schnell klar, dass sie uns in fünf oder sechs Stunden sicherlich einholen würden. Uns wurde klar, dass wir uns auf den Kampf vorbereiten mussten. Wir hatten zwölf Kanonen und der Feind hatte achtzehn.
Gegen drei Uhr nachmittags holte uns das Räuberschiff ein, doch die Piraten machten einen großen Fehler: Statt uns vom Heck zu nähern, näherten sie sich uns von der Backbordseite, wo wir acht Kanonen hatten. Wir nutzten ihren Fehler aus, richteten all diese Waffen auf sie und feuerten eine Salve ab.
Es waren mindestens zweihundert Türken, also antworteten sie auf unser Feuer nicht nur mit Kanonen, sondern auch mit einer Waffensalve von zweihundert Kanonen.
Glücklicherweise wurde niemand getroffen, alle blieben gesund und munter. Nach diesem Kampf zog sich das Piratenschiff eine halbe Meile zurück und begann, sich auf einen neuen Angriff vorzubereiten. Wir haben uns unsererseits auf eine neue Verteidigung vorbereitet.
Diesmal kamen die Feinde von der anderen Seite auf uns zu und enterten uns, das heißt, sie hingen mit Haken an unserer Seite fest; Ungefähr sechzig Leute stürmten auf das Deck und beeilten sich zunächst, die Masten und das Gerät zu zerschneiden.
Wir begegneten ihnen mit Gewehrfeuer und räumten zweimal das Deck von ihnen, mussten uns aber dennoch ergeben, da unser Schiff nicht mehr für eine weitere Reise geeignet war. Drei unserer Männer wurden getötet und acht verletzt. Wir wurden als Gefangene in die Hafenstadt Saleh gebracht, die den Mauren gehörte.
Die anderen Engländer wurden ins Landesinnere geschickt, an den Hof des grausamen Sultans, aber der Kapitän des Räuberschiffs behielt mich bei sich und machte ihn zu seinem Sklaven, weil ich jung und flink war.
Ich weinte bitterlich: Ich erinnerte mich an die Vorhersage meines Vaters, dass mir früher oder später Ärger passieren würde und mir niemand zu Hilfe kommen würde. Ich dachte, dass ich es war, der solch ein Unglück erlitten hatte. Leider hatte ich keine Ahnung, dass noch schlimmere Probleme bevorstehen.
Da mich mein neuer Herr, der Kapitän des Räuberschiffs, bei sich gelassen hatte, hoffte ich, dass er mich mitnehmen würde, wenn er erneut Seeschiffe ausrauben würde. Ich war fest davon überzeugt, dass er am Ende von einem spanischen oder portugiesischen Kriegsschiff gefangen genommen werden würde und ich dann meine Freiheit zurückerhalten würde.
Doch bald wurde mir klar, dass diese Hoffnungen vergebens waren, denn als mein Herr zum ersten Mal zur See fuhr, ließ er mich zu Hause, um die niedere Arbeit zu erledigen, die Sklaven normalerweise verrichten.
Von diesem Tag an dachte ich nur noch an Flucht. Aber es war unmöglich zu entkommen: Ich war allein und machtlos. Unter den Gefangenen gab es keinen einzigen Engländer, dem ich vertrauen konnte. Ich schmachtete zwei Jahre lang in Gefangenschaft, ohne die geringste Hoffnung auf Flucht. Aber im dritten Jahr gelang mir trotzdem die Flucht. Es ist so passiert. Mein Herr fuhr ständig, ein- oder zweimal in der Woche, mit einem Schiff an die Küste, um zu fischen. Auf jeder dieser Reisen nahm er mich und einen Jungen mit, der Xuri hieß. Wir ruderten fleißig und unterhielten unseren Meister, so gut wir konnten. Und da ich mich außerdem als guter Fischer erwies, schickte er uns beide – mich und diesen Xuri – manchmal zum Fischen unter der Aufsicht eines alten Mauren, seines entfernten Verwandten.
Eines Tages lud mein Herr zwei sehr bedeutende Mauren ein, mit ihm auf seinem Segelboot zu fahren. Für diese Reise bereitete er große Vorräte an Lebensmitteln vor, die er abends auf sein Boot schickte. Das Boot war geräumig. Der Eigner befahl vor zwei Jahren seinem Schiffsschreiner, darin eine kleine Kabine und in der Kabine eine Speisekammer für Proviant zu bauen. Ich habe alle meine Vorräte in dieser Speisekammer untergebracht.
„Vielleicht wollen die Gäste jagen“, sagte mir der Besitzer. - Nehmen Sie drei Kanonen vom Schiff und bringen Sie sie zum Boot.
Ich tat alles, was mir befohlen wurde: Ich wusch das Deck, hisste die Flagge am Mast und saß am nächsten Morgen im Boot und wartete auf Gäste. Plötzlich kam der Besitzer allein und sagte, dass seine Gäste heute nicht gehen würden, da sie sich aus geschäftlichen Gründen verspäteten. Dann befahl er uns dreien – mir, dem Jungen Xuri und dem Mauren –, mit unserem Boot zum Meeresufer zu fahren, um dort Fische zu fangen.
„Meine Freunde werden mit mir zum Abendessen kommen“, sagte er, „Sobald Sie also genug Fisch gefangen haben, bringen Sie ihn hierher.“
Da erwachte in mir wieder der alte Traum von der Freiheit. Jetzt hatte ich ein Schiff, und sobald der Besitzer weg war, begann ich mit den Vorbereitungen – nicht für den Fischfang, sondern für eine lange Reise. Ich wusste zwar nicht, wohin ich meinen Weg führen sollte, aber jeder Weg ist gut – solange er die Flucht aus der Gefangenschaft bedeutet.
„Wir sollten uns etwas zu essen besorgen“, sagte ich zum Mauren. „Wir können das Essen, das der Besitzer für die Gäste zubereitet hat, nicht ungefragt essen.“
Der alte Mann stimmte mir zu und brachte bald einen großen Korb mit Semmelbröseln und drei Krüge mit frischem Wasser.
Ich wusste, wo der Besitzer eine Kiste Wein hatte, und während der Maure Proviant holte, transportierte ich alle Flaschen zum Boot und stellte sie in die Speisekammer, als ob sie zuvor für den Besitzer gelagert worden wären.
Außerdem brachte ich ein riesiges Stück Wachs mit (fünfzig Pfund schwer) und schnappte mir einen Knäuel Garn, eine Axt, eine Säge und einen Hammer. All dies war später für uns sehr nützlich, insbesondere das Wachs, aus dem wir Kerzen hergestellt haben.
Ich habe mir einen weiteren Trick ausgedacht und wieder gelang es mir, den einfältigen Mauren zu täuschen. Sein Name war Ismael, deshalb nannten ihn alle Moli. Also sagte ich ihm:
- Beten Sie, auf dem Schiff sind die Jagdgewehre des Besitzers. Es wäre schön, etwas Schießpulver und ein paar Ladungen zu besorgen – vielleicht haben wir das Glück, zum Abendessen ein paar Watvögel zu erschießen. Ich weiß, dass der Besitzer Schießpulver und Schüsse auf dem Schiff aufbewahrt.
„Okay“, sagte er, „ich bringe es.“
Und er brachte eine große Ledertasche mit Schießpulver – eineinhalb Pfund schwer, vielleicht auch mehr – und eine weitere mit Schrot – fünf oder sechs Pfund. Er nahm auch die Kugeln ab. All dies wurde im Boot aufbewahrt. Außerdem befand sich in der Kapitänskajüte noch etwas Schießpulver, das ich in eine große Flasche füllte, nachdem ich zuvor den restlichen Wein ausgeschüttet hatte.
Nachdem wir uns mit allem Notwendigen für eine lange Reise eingedeckt hatten, verließen wir den Hafen wie zum Angeln. Ich habe meine Angelruten ins Wasser gesteckt, aber nichts gefangen (ich habe meine Angelruten absichtlich nicht herausgezogen, als der Fisch am Haken war).
„Wir werden hier nichts fangen!“ - Ich sagte zum Mauren. „Der Besitzer wird uns nicht loben, wenn wir mit leeren Händen zu ihm zurückkehren.“ Wir müssen weiter aufs Meer hinaus vordringen. Vielleicht beißt der Fisch abseits des Ufers besser zu.
Der alte Maure ahnte keine Täuschung, stimmte mir zu und hob, da er am Bug stand, das Segel.
Ich saß am Steuer, am Heck, und als sich das Schiff drei Meilen aufs offene Meer hinausbewegte, begann ich zu treiben – als wollte ich wieder mit dem Angeln beginnen. Dann übergab ich dem Jungen das Steuerrad, stieg auf den Bug, näherte mich dem Mauren von hinten, hob ihn plötzlich hoch und warf ihn ins Meer. Er tauchte sofort wieder auf, denn er schwebte wie ein Korken, und rief mir zu, ich solle ihn ins Boot nehmen, und versprach, dass er mit mir bis ans Ende der Welt fahren würde. Er schwamm so schnell hinter dem Schiff her, dass er mich sehr bald eingeholt hätte (der Wind war schwach und das Boot bewegte sich kaum). Da ich sah, dass der Maure uns bald überholen würde, rannte ich zur Hütte, nahm eines der Jagdgewehre dort, zielte auf den Mauren und sagte:
„Ich wünsche dir nichts Böses, aber lass mich jetzt in Ruhe und komm schnell nach Hause!“ Du bist ein guter Schwimmer, das Meer ist ruhig, du kannst problemlos bis zum Ufer schwimmen. Dreh dich um und ich werde dich nicht berühren. Aber wenn du das Boot nicht verlässt, schieße ich dir in den Kopf, weil ich entschlossen bin, meine Freiheit zu gewinnen.
Er wandte sich dem Ufer zu und schwamm sicher ohne Schwierigkeiten dorthin.
Natürlich könnte ich diesen Mauren mitnehmen, aber auf den alten Mann war kein Verlass.
Als der Mohr hinter das Boot fiel, drehte ich mich zu dem Jungen um und sagte:
- Xuri, wenn du mir treu bist, werde ich dir viel Gutes tun. Schwöre, dass du mich niemals betrügen wirst, sonst werde ich dich auch ins Meer werfen.
Der Junge lächelte, sah mir direkt in die Augen und schwor, dass er mir bis zum Grab treu bleiben und mit mir gehen würde, wohin ich wollte. Er sprach so aufrichtig, dass ich nicht anders konnte, als ihm zu glauben.
Bis sich das Moor der Küste näherte, hielt ich Kurs auf das offene Meer und kreuzte gegen den Wind, damit jeder dachte, wir würden nach Gibraltar fahren.
Doch sobald es anfing zu dämmern, begann ich nach Süden zu steuern und hielt mich dabei leicht nach Osten, weil ich mich nicht von der Küste entfernen wollte. Es wehte ein sehr frischer Wind, aber das Meer war flach und ruhig, und deshalb kamen wir in gutem Tempo voran.
Als am nächsten Tag um drei Uhr zum ersten Mal Land vor uns auftauchte, befanden wir uns bereits anderthalbhundert Meilen südlich von Saleh, weit jenseits der Grenzen der Besitztümer des marokkanischen Sultans und überhaupt aller anderen Afrikanischer König. Das Ufer, dem wir uns näherten, war völlig menschenleer. Aber in der Gefangenschaft bekam ich solche Angst und fürchtete mich so vor einer erneuten Gefangennahme durch die Mauren, dass ich den günstigen Wind ausnutzte, der mein Boot nach Süden trieb, und fünf Tage lang immer weiter segelte, ohne vor Anker zu gehen oder an Land zu gehen.
Fünf Tage später änderte sich der Wind: Er wehte aus Süden, und da ich keine Angst mehr vor einer Verfolgung hatte, beschloss ich, mich dem Ufer zu nähern und an der Mündung eines kleinen Flusses vor Anker zu gehen. Ich kann nicht sagen, um was für einen Fluss es sich handelt, wo er fließt und was für Menschen an seinen Ufern leben. Seine Ufer waren verlassen, und das freute mich sehr, da ich keine Lust hatte, Menschen zu sehen. Das Einzige, was ich brauchte, war frisches Wasser.
Wir betraten die Mündung am Abend und beschlossen, als es dunkel wurde, an Land zu schwimmen und die gesamte Umgebung zu untersuchen. Doch sobald es dunkel wurde, hörten wir schreckliche Geräusche vom Ufer: Am Ufer wimmelte es von Tieren, die so wütend heulten, knurrten, brüllten und bellten, dass der arme Xuri vor Angst fast starb und mich anflehte, bis dahin nicht an Land zu gehen Morgen.
„Okay, Xuri“, sagte ich zu ihm, „lass uns warten!“ Aber vielleicht werden wir bei Tageslicht Menschen sehen, unter denen wir vielleicht noch schlimmer leiden werden als unter den wilden Tigern und Löwen.
„Und wir werden diese Leute mit einer Waffe erschießen“, sagte er lachend, „und sie werden weglaufen!“
Ich war froh, dass sich der Junge gut benahm. Damit er in Zukunft nicht entmutigt wird, schenkte ich ihm einen Schluck Wein.
Ich befolgte seinen Rat und wir blieben die ganze Nacht vor Anker, ohne das Boot zu verlassen und unsere Waffen bereitzuhalten. Wir mussten bis zum Morgen kein Auge zudrücken.
Welches Buch hat den längsten Titel?
Lassen Sie uns einen Hinweis geben: Der Titel hat dreihundertvierzehn Buchstaben! Kinder kennen dieses Buch als „Die Abenteuer des Robinson Crusoe“.
Überlegen Sie also, oder lesen Sie besser:
„Das Leben, die außergewöhnlichen und erstaunlichen Abenteuer von Robinson Crusoe, einem Seemann aus York, der achtundzwanzig Jahre lang ganz allein auf einer unbewohnten Insel vor der Küste Amerikas, nahe der Mündung des großen Orinoco-Flusses, lebte, wo er von einem... Schiffbruch, bei dem die gesamte Schiffsbesatzung außer ihm starb, mit einem Bericht über seine unerwartete Freilassung durch Piraten. Von ihm selbst geschrieben.
Der Autor des Buches war Daniel Defoe (1660/61–1731), der unter seinem eigenen Namen und verschiedenen Pseudonymen zahlreiche Werke verfasste: Romane und Essays, Broschüren und Abhandlungen, Handbücher und Ratschläge, ein Gedicht über die Malerei und eine allgemeine Geschichte des Handwerks . Aber im Gedächtnis von Generationen wird er für immer der Schöpfer eines erstaunlichen Buches bleiben. Es gibt Schiffbrüche und Verfolgungsjagden, Piraten und Räuber, Schießereien und Fluchten. Dieses Buch hat Rekorde hinsichtlich der Anzahl der Auflagen, Fälschungen und Nachahmungen gebrochen.
Aber lassen Sie uns zunächst über sein Aussehen sprechen. Die Geschichte des Seemanns, die als Prototyp für die Entstehung der Geschichte über Robinson diente, geschah tatsächlich und war keine Erfindung eines Liebhabers fantastischer Geschichten.
Alexander Selkreg wurde 1676 in Schottland an der Nordseeküste in der Stadt Largo in der Familie eines Schuhmachers geboren. Der Vater wollte, dass seine Söhne die Dynastie fortführen. Einer machte es gut, aber Alexander langweilte sich in der Werkstatt. Er fühlte sich unwiderstehlich zur Red Lion Taverne hingezogen, wo sich erfahrene Seeleute versammelten. Er versteckte sich hinter den Fässern und lauschte Geschichten über den „Fliegenden Holländer“ – ein Segelschiff mit einer Besatzung aus Toten, über das Land des Goldes Eldorado, über tapfere Seeleute und grausame Stürme, über gewagte Überfälle von Korsaren und geplünderte Reichtümer.
Der Junge hörte oft von seinem Vater: „Was für ein Idiot du bist, Sandy, und deine Hände wachsen an der falschen Stelle!“ Und dieser Vorwürfe war der junge Mann so überdrüssig, dass er sein Zuhause verließ, seinen Nachnamen änderte und Seemann wurde. Jetzt hieß er Sandy Selkirk.
Auf dem Schiff stellte sich heraus, dass Sandys Hände in Ordnung waren und auch sein Kopf. Hier hat alles super geklappt! Und der junge Mann, der davon träumte, ein erfahrener Seemann zu werden, wurde Teil der Besatzung des berühmten Piraten Pickering.
Sandy wurde nicht nur eine Piratin, sondern eine königliche Piratin. Damals war es eine Ehre, der Königin von England zu dienen. Die Spanier und Portugiesen entdeckten Amerika, erklärten es zu ihrem Eigentum, exportierten Gold, die Briten durften dort nicht hin und versenkten englische Schiffe. Und die Piraten nahmen ihre Beute für die Königin von England mit.
Leider wurde das Schiff, auf dem Alexander segelte, bald von französischen Piraten gekapert. Der junge Seemann wurde gefangen genommen und in die Sklaverei verkauft. Doch es gelang ihm, sich zu befreien und wurde auf einem anderen Piratenschiff angeheuert. Er kehrte mit einem goldenen Ohrring im Ohr und einer prall gefüllten Brieftasche nach Hause zurück. Doch das ruhige Leben wurde schnell langweilig.
Im Jahr 1703 wurde der 27-jährige Alexander Mitglied der Besatzung der neuen Expedition von William Dampier, einem leidenschaftlichen Naturforscher und Reisenden, der die Welt umrundete und Zeitschriften veröffentlichte, in denen Geschichten über seine eigenen Abenteuer und Piraten mit Beschreibungen der Piraten durchsetzt waren Natur ferner Länder, Hinweise zur Geographie und Navigation.
Der berühmte Kapitän bereitete sich auf zwei Schiffen darauf vor, nach Westindien zu segeln, um Gold zu holen. Diese Aussicht gefiel dem Schotten, der das Meer und die Abenteuer „krank“ hatte; er sollte als Bootsmann auf der 16-Kanonen-Galeere „Sank Port“ dienen. Zur Flottille gehörte neben ihr auch die 26-Kanonen-Brigg „St. George“ – ein Geschenk des Königs von England.
Ziel des Feldzugs war es, spanische Schiffe anzugreifen und Städte an Land zu erobern. Kurs – südliche Meere, lateinamerikanische Länder. Kurz gesagt, eine für die damalige Zeit typische Raubexpedition unter dem Motto des Kampfes Englands gegen das feindliche Spanien.
Die Reise verlief zunächst ruhig, doch dann stirbt der Kapitän des Schiffes „Sank Port“, auf dem Selkirk diente. Dampier ernennt einen neuen Mann – Thomas Stradling, einen Mann mit einem harten und grausamen Wesen. Von da an begannen die Schwierigkeiten. Und das nicht nur, weil Bootsmann Selkirk kein gutes Verhältnis zum neuen Kapitän hatte.
Der Weg führte nun durch nahezu unerforschte Meere. Eineinhalb Jahre lang wanderten die Schiffe um den Atlantik herum und unternahmen gewagte Überfälle auf spanische Schiffe. Und dann gelangten sie, dem Magellan-Weg folgend, in den Pazifischen Ozean. Die Schiffe trennten sich vor der chilenischen Küste. „Sank Port“ steuerte die Inseln des Juan-Fernandez-Archipels an, wo er sich mit Frischwasser eindecken wollte. Hier fanden die Ereignisse statt, dank derer der Name Alexander Selkirk in der Geschichte blieb.
Nach einem weiteren Streit mit Kapitän Stradling beschloss Bootsmann Selkirk, den Sank Port zu verlassen, der zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich heruntergekommen und undicht war. Im Oktober 1704 erschien im Schiffstagebuch ein Eintrag: „Alexander Selkirk wurde auf eigenen Wunsch vom Schiff entlassen.“ Sie beluden das Boot mit einer Steinschlosspistole und einem Pfund Schießpulver, Kugeln und Feuerstein, Kleidung und Wäsche, Tabak, einer Axt, einem Messer, einem Kessel und vergaßen nicht einmal die Bibel.
Selkirk entschied sich für die unbewohnte Insel Masa Tierra, was „näher an der Küste“ bedeutet, 600 km westlich von Chile, anstatt auf einem heruntergekommenen Schiff unter dem Kommando eines feindlichen Kapitäns zu bleiben. In seinem Herzen hoffte er, dass er nicht lange auf der Insel bleiben müsste, denn Schiffe kamen hierher, um frisches Wasser zu holen. Mehrere Tage lang lag er am Ufer: Er weinte, dann betete er und dann wurde ihm klar, dass das nichts nützte, er konnte nicht verzweifeln und die Hoffnung verlieren. Und dann begann er, ein Haus zu bauen, wilde Ziegen zu zähmen und im Garten Getreide zu säen. Er verhungerte nicht – es gab viel Obst auf der Insel.
Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt: Der wärmste Monat ist der Februar und der kälteste Monat der August. Die höchste Temperatur im Sommer betrug +19 Grad und die niedrigste im Winter +12 Grad. Du kannst leben.
Die Zeit verging, aber es gab keine schnelle Befreiung. Wohl oder übel musste ich mich ernsthaft mit einem im Meer verlorenen Stück Land zufrieden geben. Nach der Untersuchung des „Besitzes“ stellte Selkirk fest, dass die Insel mit dichter Vegetation bedeckt war und etwa 20 km lang und 5 km breit war. Am Ufer können Sie Schildkröten jagen und ihre Eier im Sand sammeln. Vögel gab es in Hülle und Fülle, und vor der Küste wurden Hummer und Robben gefunden.
Die ersten Monate waren besonders schwierig. Und das nicht so sehr wegen des stündlichen Kampfes ums Dasein, sondern wegen der Einsamkeit. Wie er später selbst sagte, dauerte es 18 Monate, bis er sich mit dem Einsiedlerdasein abgefunden hatte. Manchmal überkam Selkirk Angst: Was wäre, wenn dieses freiwillige Exil lebenslang wäre? Und er verfluchte sowohl das Land, das ihn im Meer beschützte, als auch die Stunde, in der er sich zu einer überstürzten Tat entschloss.
Und doch ließ ihn die Hoffnung nicht los. Jeden Tag bestieg Selkirk den höchsten Berg und blickte stundenlang auf den Horizont. Es bedurfte einer Menge Arbeit und Erfindungsreichtum, um ein „normales“ Leben auf der Insel zu etablieren. Er baute zwei Hütten aus Baumstämmen und Blättern. Einer diente ihm als „Büro“ und „Schlafzimmer“, während er im anderen Essen zubereitete. Als das Kleid baufällig wurde, nähte er mit einem einfachen Nagel Kleidung aus Ziegenfellen. Er fertigte die Truhe selbst an und verzierte sie mit kunstvollen Schnitzereien: Er verwandelte eine Kokosnuss in einen Trinkbecher.
Wie die Naturvölker lernte er, durch Reibung Feuer zu machen, und als das Schießpulver zur Neige ging, begann er, mit seinen Händen wilde Ziegen zu fangen. Einmal fiel er während einer solchen „manuellen“ Jagd mit einer Ziege in den Abgrund und lag drei Tage lang bewusstlos da.
Eine echte Katastrophe für ihn waren die Ratten, die um die Hütte herumwuselten und alles annagten, was sie konnten. Um sie loszuwerden, musste er Wildkatzen zähmen, die mit Schiffen auf die Insel gebracht wurden.
Und so lebte er fast fünf Jahre auf der Insel. Er hatte keinen Freitag. Er hatte jedoch Gelegenheit, Menschen zu sehen: Ein Schiff fuhr zur Insel, die mehrere Tage in der Bucht stand, und Sandy versteckte sich die ganze Zeit im Dickicht. Er kam zu dem Schluss, dass es besser sei, auf einer einsamen Insel zu leben, als auf einer Rahe herumzuhängen. Er wollte wirklich nicht gefunden und an den Galgen geschickt werden. Schließlich handelte es sich um ein spanisches Schiff, und England befand sich im Krieg mit Spanien.
Alexander verbrachte eintausendfünfhundertachtzig Tage und Nächte allein mit der Natur. Was für eine Anstrengung an körperlicher und moralischer Stärke! Wie kann man nicht in Verzweiflung verfallen, sich nicht von der Verzweiflung überwältigen lassen?! Harte Arbeit hat geholfen – das beste Heilmittel gegen Krankheit und Einsamkeit. Und auch Beharrlichkeit beim Erreichen von Zielen, Unternehmertum.
Zu Beginn des Jahres 1709 endete Selkirks Einsiedelei: Am 31. Januar mittags bemerkte er einen Punkt von seinem Beobachtungsposten aus. Segel! Wird das Schiff wirklich vorbeifahren? Geben Sie bald ein Zeichen! Das englische Kriegsschiff Duke ging vor Anker und ein Boot ging an Land, um frisches Wasser zu holen. Man kann sich vorstellen, wie überrascht die Seeleute waren, als sie am Ufer einen „wilden Mann“ in Tierfellen trafen, überwuchert, unfähig, ein Wort zu sagen. Während er alleine lebte, vergaß der Seemann völlig zu sprechen und murmelte etwas Unverständliches.
Aber der Kapitän, der herausgefunden hatte, wer er war, sagte: „Sie haben hier viel gelitten, aber Gott sei Dank, denn diese Insel hat Ihnen das Leben gerettet!“ Kurz nach Ihrer Landung geriet Ihr Schiff in einen Sturm und sank mit fast seiner gesamten Besatzung, und der überlebende Kapitän und mehrere Matrosen fielen in die Hände der Spanier.“
Erst am 14. Oktober 1711 kehrte Alexander Selkirk nach England zurück. Es schien, als würde er nach solchen Schwierigkeiten, nachdem er zur Besinnung gekommen war, nach Largo zurückkehren und mit der Schuhmacherei beginnen. Aber nein, der Seemann wird ein königlicher Pirat – ein Assistent von Kapitän Rogers auf dem Schiff Duchess.
Drei Jahre später schrieb er das Buch „The Intervention of Providence, or the Extraordinary Description of the Adventures of Alexander Selkirk, Written by His Own Hand“. Als die Londoner von den Abenteuern seines Landsmanns erfuhren, wurde er populär. Doch bald wurde der Seemann in der Öffentlichkeit langweilig, da er nicht wusste, wie er seine Erlebnisse interessant schildern sollte. Sein Aufenthalt auf der Insel verlief für ihn nicht spurlos: Sein düsterer Blick schreckte die Menschen ab, sein Schweigen und seine Isolation irritierten ihn. Bis zu seinem Tod war Alexander ein königlicher Pirat, der auf Schiffen segelte – er liebte das Meer mehr als das Land und zog die Gefahr dem Frieden vor.
Selkirks Buch war kein Erfolg; sie sagten, es sei langweilig geschrieben. Diese Arbeit interessierte jedoch Daniel Defoe, der diese Geschichte stark veränderte und ein weiteres Buch veröffentlichte. Das, was jeder liest und kennt – über Robinson Crusoe.
Das Leben von Daniel Defoe ist voller Wechselfälle und Abenteuer und nicht weniger interessant als das Leben seines Helden. Als Sohn eines armen Bürgers wusste Defoe, dass nur Reichtum eine verlässliche und starke Position in der Gesellschaft verschaffen konnte. Er eilte von einer kommerziellen Veranstaltung zur nächsten, wurde reich und ging pleite. Kommerzielle Misserfolge wurden oft hundertfach durch literarische Tätigkeit kompensiert.
Mehr über das Leben des englischen Schriftstellers Daniel Defoe und die Entstehung des Buches über die Abenteuer von Robinson Crusoe erfahren Sie im Essay von Vl. Sashonko „Pen and Whip“.
Vl. Sashonko
Feder und Peitsche
Ein Buch, das bereits ein Vierteljahrtausend alt ist, aber immer mehr Generationen junger Leser Freude am Entdecken bereitet, ist ein wirklich glückliches Buch. Es gibt kaum einen Menschen, der „Robinson Crusoe“ nicht seit seiner Kindheit kennt und liebt. Robinson wurde 1719 veröffentlicht. Allerdings haben nur wenige Menschen einen ebenso spannenden Abenteuerroman gelesen wie das Leben des Autors dieses Buches – Daniel Defoe.
Nein, er erlitt keine Schiffbrüche wie Crusoe, kämpfte nicht gegen Kannibalen und verbrachte fast sein gesamtes Leben auf den seit langem bewohnten britischen Inseln. Und doch war sein Leben so ungewöhnlich, dass ein Wissenschaftler sein Buch über ihn betitelte: „Das Leben und die Abenteuer von Daniel Defoe, Autor von Robinson Crusoe“ ...
Defoe lebte in der turbulenten Ära, die auf die englische bürgerliche Revolution im 17. Jahrhundert folgte. Er wurde 1660 in die Familie des Londoner Lebensmittelhändlers und Kerzenhändlers James Faw hineingeboren. Viel später, als er sich dem königlichen Hof näherte, fügte Daniel selbst seinem gebräuchlichen Kaufmannsnamen Fo den Adelsbestandteil „de“ hinzu. Er verfasste für sich sowohl ein Wappen als auch einen lateinischen Wahlspruch. Obwohl dies den selbsternannten Adligen nicht zum Aristokraten machte, löste es doch ständigen Spott und Sticheleien bei seinen Feinden aus. Aber Defoe hatte viele Feinde. Und persönlich und politisch und religiös. Sein ganzes Leben lang musste er sich wie auf Messers Schneide zwischen ihnen manövrieren ...
Nachdem er für die damalige Zeit eine sehr gute Ausbildung erhalten hatte, wurde Daniel im Alter von sechzehn Jahren wie sein Vater Geschäftsmann und zeigte in dieser Angelegenheit außergewöhnliche Fähigkeiten. Bereits im Alter von achtzehn Jahren schloss er selbständig große Geschäfte ab und begann bald, die Handelshäfen Englands und Europas zu bereisen. Defoe besuchte Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Holland.
Nach seiner Rückkehr nach London ließ sich der junge Kaufmann dort fest und für immer nieder und verließ England keinen einzigen Tag. Doch dann bereiste er die gesamte Länge und Breite der britischen Inseln und kannte sie so gut, dass er in seinen letzten Jahren ein dreibändiges Buch mit dem Titel „Eine Reise über die gesamte Insel Großbritanniens“ schrieb, aus dem das Buch wurde erster Führer durch das Land.
So ließ sich der 23-jährige Daniel Fo 1683 im geschäftigsten Viertel der City of London nieder, wie das Geschäftszentrum der britischen Hauptstadt seit der Antike genannt wird. Daniels Hauptberuf war der Handel mit Kurzwaren und Hüten. Er liebte es, große und oft sehr riskante Handelsspiele zu spielen. Genauso wird sich Defoe in der Politik verhalten, in die er sich neben der Wirtschaft bald vertiefen wird.
Nachdem Daniel sich in seinem Laden vor dem Eingang zur Change Alley niedergelassen hatte, liebte er es, seinen Ruf nicht nur als angesehener Geschäftsmann, sondern auch als Witzbold, Literaturkenner und Schriftsteller aufrechtzuerhalten.
Im Jahr 1691 stellte Defoe seine Feder zum ersten Mal auf die Probe – eine scharfe und lebendige, die ihm später Hunderte von Triumphen und Tausende von Schwierigkeiten bescheren sollte: Er schrieb mehrere poetische Satiren zum Thema des Tages ... Aber bevor das Publikum zahlte Aufmerksamkeit erregte der frischgebackene Kaufmann-Schriftsteller, der Kaufmann-Kaufmann musste Konkurs anmelden. Bedrängt durch zahlreiche ungünstige Umstände gelang es ihm nicht, alle Gläubiger zu begleichen, die plötzlich die Rückgabe der ihm gegebenen Geldbeträge forderten.
Damals wurden Bankrotteure sehr hart bestraft. Und so nahm Defoe es, wie alle unbezahlten Schuldner dieser Zeit, und verschwand im Münzviertel. Dort befand er sich sofort in der Gesellschaft der berüchtigtsten Betrüger und Straßenräuber. Allerdings gefiel ihm die Gangsterhöhle nicht und erregte Entsetzen und Ekel. Sobald sich die Gelegenheit bot, floh Defoe heimlich nach Bristol, versteckte sich dort viele Wochen lang und ging nur abends an die frische Luft.
In der Zwischenzeit gelang es Defoes Frau und seinen Freunden, die Angelegenheit irgendwie zu regeln, und als er nach London zurückkehrte, stürzte er sich wieder kopfüber in den Handel und ... ins Schreiben. „Die Erfahrung bestimmter Projekte“ war der Titel des ersten großen Werks, das Defoe veröffentlichte. Darin ging es um politische und soziale Reformen, die laut Defoe durchgeführt werden mussten, um England stark und wohlhabend zu machen.
Die Abhandlung erregte die Aufmerksamkeit des königlichen Hofes und der Regierung. Defoe wurde großzügig belohnt. Es gelang ihm, ausreichend Kapital zu sammeln und in der Nähe von London eine Ziegel- und Ziegelfabrik zu errichten, die beträchtliche Einnahmen zu erwirtschaften begann. Gleichzeitig leitete Defoe die königliche Kommission zur Erhebung der Glassteuer, war Manager und Kontrolleur der königlichen Lotterien, betrieb den geschäftigsten Handel mit Stoffen und Wein, verfasste satirische Broschüren und Satiren in Versen zu aktuellen Themen und veröffentlichte sie unter anderem war damals üblich, anonym, also ohne Nennung des Namens des Autors.
Der Ruhm eines erfolgreichen Unternehmers wurde durch den immer lauter werdenden Ruhm eines satirischen Schriftstellers ergänzt. Für außerordentliche Aufregung sorgte Defoes Broschüre, die die dominierende anglikanische Kirche im Land und ihre höchsten Geistlichen treffend angriff. Die Regierung von Königin Anne, die nach dem Tod Wilhelms von Oranien den Thron bestieg, ordnete die Verhaftung von Defoe an, „der sich der Verbrechen und Vergehen von größter Bedeutung schuldig gemacht hat“.
Der rastlose Kaufmann und Pamphletschreiber musste erneut fliehen, diesmal jedoch nicht vor den Gläubigern, sondern vor dem Gericht. Er flüchtete erneut in eines der vielen Verstecke, die die City of London für von der Polizei gesuchte Kriminelle bereitstellte. Nur seine Frau wusste von seinem Aufenthaltsort. Unterdessen bot die London Gazette jedem, der Daniel Defoe den Behörden übergeben würde, fünfzig Pfund Sterling an und beschrieb die Merkmale des Verbrechers. Das Parlament erklärte seine Broschüre für aufrührerisch und er wurde von der Hand des Henkers verbrannt.
Defoe versteckte sich fünf Monate lang, doch am Ende wurde ein Informant gefunden, der ihn verriet. Daniel Defoe wurde in das Newgate-Gefängnis gebracht. Aber auch hier schrieb er weiterhin Broschüren und verschickte sie an Verlage.
Das Gericht verurteilte Defoe zu einer Geldstrafe, dazu, dreimal auf dem Platz an den Pranger gestellt zu werden, und zu einer Haftstrafe in Newgate, „solange es der Königin gefällt“.
Am 29. Juli 1703 wurde der Pamphletschreiber in Begleitung der Wachen zum Pranger auf dem Platz vor der Königlichen Börse geführt. Die Säule stand auf dem Bahnsteig. In seinem oberen Teil befand sich ein Block mit Löchern für Kopf und Hände. Defoe war an einen Pfosten gefesselt.
Allerdings machte er nicht den Eindruck eines unglücklichen Sträflings – vielmehr war er ein Gewinner, der sich über die Machthaber lustig machte, über diejenigen, die die Entwicklung der Gesellschaft bremsen wollten. Bereits kurz zuvor im Gefängnis schrieb Defoe „Hymn to the Pillory“, das seine Freunde druckten und unter den Londonern verteilten.
In seiner „Hymne“ erklärte Defoe, dass er zu Unrecht verurteilt wurde und dass die Menschen, die ihn zu einer schändlichen Strafe verurteilten, unehrlich waren. Sie rächten sich an ihm für seinen Mut, dafür, dass er sich gegen die Ungerechtigkeit auflehnte ...
Diese poetische Satire hatte, wie Defoes gesamtes Verhalten, große gesellschaftliche Bedeutung im Kampf um Gedankenfreiheit.
Der Verurteilte wurde noch zweimal auf den Scheiterhaufen gebracht – am 30. und 31. Juli. Doch die Zeremonie, die nach Ansicht des Klerus Defoe für immer in Ungnade bringen und aus dem öffentlichen Leben verbannen sollte, wurde zu seinem beispiellosen Triumph.
Das Gerüst war von Tausenden Londonern umgeben, die statt Dreck, faulen Eiern und faulen Gurken Blumen auf Defoe warfen, und er lächelte sie von oben an. Am dritten Tag wurde aus Jubel und Applaus ein regelrechter Aufruhr. Noch bevor Daniel den Platz erreichte, war der Pranger mit Grünpflanzen geschmückt. Während der Hinrichtung gab es ständigen Jubel zu seinen Ehren und Beschimpfungen der Regierung, die so unfair gehandelt habe. Weinkrüge gingen durch die Menge. Auf einem Knie kniend tranken die Londoner auf Defoes Gesundheit und beschämten seine Feinde. Von allen Seiten reichten sie ihm Blechkrüge voller Wein oder Bier, sie warfen Blumenkränze ...
So bewies Defoe der Regierung von Königin Anne, dass die Feder mächtiger ist als die Peitsche. Er hat das mehr als einmal bewiesen, er hat es allen seinen Zeitgenossen, Freunden und Feinden bewiesen.
Als Defoe fünf Monate später aus dem Gefängnis kam, stürzte er sich in einen rasanten Strom verschiedenster Aktivitäten, die ihn wie immer völlig in seinen Bann zogen: den Handel mit all seinen unzähligen Feinheiten, die Ausführung geheimer Regierungsaufträge als politischer Geheimdienstagent, was auch immer der Fall war verbunden mit ständigem Reisen durch das Land und der Notwendigkeit, verschiedene Rollen zu spielen, oft unter Lebensgefahr, Broschüren, Gedichte, fantastische Satiren, Essays und große Bücher-Abhandlungen zu verschiedenen Themen zu schreiben.
Hinzu kam auch der Journalismus. Defoe begann mit der Herausgabe der Zeitung Review, die dreimal pro Woche auf vier Seiten in kleinem Format erschien. Defoe schrieb die gesamte Zeitung allein, selbst: Auch wenn er weg war, wurde die Zeitung weiterhin veröffentlicht, da Defoe, wo immer er war, sein Druckmaterial für die nächsten Ausgaben schickte.
Defoes Energie und Arbeitsfähigkeit sind wirklich erstaunlich. Auch hier schwebte mehr als einmal die eine oder andere Bedrohung über ihm – Bankrott, Verhaftung, Gefängnis oder Mord um die Ecke, aber er verlor nie seine Geistesgegenwart, seinen Mut und sein Selbstvertrauen. Er hatte Gelegenheit, sich auf Nahkämpfe einzulassen, mit Schwertern zu kämpfen ...
Defoe war bereits fast sechzig, als er, nachdem er sich aus politischen Angelegenheiten zurückgezogen und sich in den ruhigen Londoner Vorort Stoke Newington zurückgezogen hatte, beschloss, ein Buch über das Leben eines einsamen Reisenden auf einer einsamen Insel zu schreiben. Was brachte ihn auf diese Idee?
Zu dieser Zeit war die Geschichte des schottischen Seemanns Alexander Selkirk in England bereits weithin bekannt, der wegen eines Streits mit dem Kapitän des Schiffes vor etwa siebenhundert Jahren auf der unbewohnten Insel Juan Fernandez im Pazifischen Ozean gelandet und zurückgelassen wurde Kilometer von der Küste Chiles entfernt. Dort verbrachte er fast viereinhalb Jahre in völliger Einsamkeit und geriet in einen wilden Zustand, in dem er die Fähigkeit zu sprechen verlor. Er wurde von Kapitän Rogers gerettet und nach England gebracht, der 1709 die Welt umsegelte.
Die Nachricht von Selkirks Abenteuern verbreitete sich schnell im ganzen Land. Kapitän Woods Rogers selbst schrieb über sie in seinem Aufsatz „Eine Reise auf einem Schiff um die Welt“, und ein anderer Seefahrer, Kapitän Edward Cook, widmete ihnen sein Buch. Ein kurzer Aufsatz über das Schicksal von Selkirk wurde vom Schriftsteller Richard Steele in der Zeitschrift Englishman veröffentlicht.
Auch andere Geschichten von Seeleuten, die sich in ungewöhnlichen Situationen befanden, waren bekannt. Es besteht die Vermutung, dass sich Defoe auch mit Selkirk getroffen hat. Doch dann war Defoe so mit allen möglichen Dingen beschäftigt, dass er keine Zeit für die Abenteuer eines Seemanns hatte. Er erinnerte sich später an sie, als er sich aus dem aktiven öffentlichen Leben zurückzog und freie Zeit hatte und außerdem Geld für die Mitgift seiner Töchter verdienen musste.
Defoe griff nach seinem Stift. Als erstes hat er sich natürlich einen Titel ausgedacht – lang, sehr lang, aber sehr attraktiv. Damit ihm niemand vorwerfen konnte, die Abenteuer von Alexander Selkirk einfach nacherzählt zu haben, verlegte Defoe nicht nur eine unbewohnte Insel vom Pazifischen Ozean in den Atlantik an der Mündung des Orinoco, sondern bevölkerte nicht nur die umliegenden tropischen Inseln samt Kannibalen, auch... Pinguine und Robben, verlegte die Handlung aber auch ein halbes Jahrhundert früher, ins 17. Jahrhundert.
Der Verleger, dem Defoe den Titel zeigte, spürte den Nutzen und bestellte ihm ein Buch, das auf der vorgeschlagenen Handlung basierte und etwa 30 Seiten umfasste. Defoe schrieb Robinson mit beispielloser Geschwindigkeit und vollendete es in wenigen Wochen.
Am 25. April 1719 erschien das Buch und war blitzschnell ausverkauft. Es war ein enormer Erfolg, zumal viele die autobiografischen Memoiren von Robinson Crusoe für bare Münze nahmen: Der Name des wahren Autors war schließlich nirgends aufgeführt.
Inspiriert vom Erfolg schrieb Defoe in drei Monaten eine Fortsetzung von Robinsons Abenteuern – über seine Rückkehr auf die Insel, über die Reise nach Madagaskar, Indien, China und über den Übergang von Peking nach Archangelsk. Bereits am 20. August desselben Jahres 1719 kam der zweite Band in den Handel. Es wurde auch von den Lesern mit Begeisterung aufgenommen. Und nur der dritte Band, der ein Jahr später langweilig und moralisierend erschien, war kein Erfolg.
Im Laufe seines langen Lebens schuf Defoe fast vierhundert Werke, darunter viele dicke Romane, die nach Robinson geschrieben wurden. Aber nur „Robinson Crusoe“ war dazu bestimmt, seinen Namen zu verewigen, obwohl Defoe selbst dies nicht ahnte.
Die in viele Sprachen übersetzten „Abenteuer von Robinson“ wurden von Schriftstellern und Dichtern sowie jungen und erwachsenen Lesern des 18. und 19. Jahrhunderts bewundert. Defoes Buch wurde 1762 erstmals auf Russisch veröffentlicht und ist seit mehr als zweihundertfünfzig Jahren ein guter Begleiter unserer Landsleute.
Robinson ist aus der Weltliteratur nicht mehr wegzudenken; es ist unmöglich, sich einen Menschen vorzustellen, der als Kind nicht das unsterbliche Buch über die Abenteuer von Robinson Crusoe gelesen hätte.
Literatur
1. Korostyleva V. Wer bist du, Robinson Crusoe? /Leser. – 2008. – Nr. 2.
2. Solomko N. Interview mit Robinson / Reader. – 2006. – Nr. 9.
3. Sashonko Vl. Feder und Peitsche / Glitzer. – 1969. – Nr. 10.